
So sanieren wir Deutschland
Hinter der glänzenden Oberfläche unserer Wohlstandsillusion haben unsere Politiker in den letzten Jahren massive Lasten aufgebaut, die bei Weitem die Leistungsfähigkeit Deutschlands übersteigen. Würden wir sauber bilanzieren, müssten wir offen eingestehen, die Versprechungen nicht erfüllen zu können. Noch müssen wir diesen Offenbarungseid nicht abgeben. Noch können wir also handeln. Von Dr. Daniel Stelter
Viel Zeit bleibt uns allerdings nicht. Schon in der nächsten Rezession wird unsere Wohlstandsillusion platzen und die Verteilungskonflikte werden offen ausbrechen. Im Fokus der Anstrengungen muss eine Neuausrichtung der Politik liegen: weg von Konsum und Wohlstandsvernichtung hin zu Investition und Wohlstandsschaffung.
Nachfolgend will ich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die wesentlichen Aspekte der Neuausrichtung umreißen:
- Leistungsfähigkeit steigern,
- Lasten gerechter verteilen,
- Altlasten bereinigen.
Kaum ein Beitrag auf DDW hat so viel Nachhall und Interesse bei unserer werten Leserschaft gefunden wie der in der letzten Woche hier publizierte Beitrag “Das Märchen von reichen Deutschland – eine Quittung”. Der Ökonom und Publizist Dr. Daniel Stelter hat darin die ungeheuren und absehbar unbezahlbaren Lasten und Verpflichtungen Deutschlands dargelegt, die Kerninhalt seines aktuell erschienenen Buches sind. Mit großer Freude können wir vermelden, dass sich der Autor bereiterklärt hat, in diesem Folgebeitrag nun auch Lösungswege aus der Misere zu skizzieren. Der Herausgeber
Leistungsfähigkeit steigern
Je stärker unsere Wirtschaft ist, umso leichter können wir die Zukunft bewältigen, den Sozialstaat erhalten, die Lasten des demografischen Wandels finanzieren und die Schäden der falschen Politik der letzten Jahrzehnte bezahlen. Es muss darum gehen, Deutschland trotz sinkender Erwerbsbevölkerung wirklich zu einem reichen Land zu machen.
Die künftigen Einkommen hängen von zwei Faktoren ab: der Anzahl der Menschen, die arbeiten (Erwerbsbevölkerung), und der Produktivität pro Kopf. Allein aufgrund des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung und der geringeren Produktivitätszuwächse ist für die kommenden Jahrzehnte in Deutschland mit einer Halbierung der Wachstumsrate der Wirtschaft auf nur noch 1 Prozent pro
Jahr zu rechnen. England und Frankreich werden dank deutlich günstigerer Demografie hingegen ihre Wachstumsraten auf einem Niveau von 2 Prozent halten können.
Erwerbsbevölkerung erhöhen
Die deutsche Erwerbsbevölkerung wird in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen. Der Versuch der Politik, diesen Rückgang durch Zuwanderung aufzufangen, funktioniert nicht. Im Gegenteil: Die Art der Zuwanderung, wie wir sie zugelassen haben, erhöht die finanziellen Lasten, statt zu einer Lösung beizutragen. Es ist an der Zeit, sich auf die eigenen Möglichkeiten zu konzentrieren.
Wir müssen den Anteil der tatsächlich erwerbstätigen Menschen steigern. Wie das geht, das wissen die Experten schon seit Langem. Wir haben viele Optionen, den Rückgang der Erwerbsbevölkerung zumindest teilweise aufzufangen.
Bezeichnenderweise hat die Politik seither genau das Gegenteil getan, wie beispielsweise durch die Rentenpolitik die Lebensarbeitszeit
faktisch verkürzt, statt sie zu verlängern. So haben rund eine Million Menschen von dem Angebot der Rente mit 63 Gebrauch gemacht. Damit fehlen nicht nur Beitragszahler, sondern vor allem Fachkräfte. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist zwar gestiegen, aber bei Weitem nicht im nötigen Maße. Außerdem fehlt es noch immer an ausreichend (guten!) Betreuungsangeboten für Kinder.
Keine Leistungen an Zuwanderer ohne Gegenleistung
Zugleich müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass der sinkende Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung auch mit der bisherigen Art der Zuwanderung zu tun hat. So wissen wir beispielsweise, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen aus der Türkei und ganz allgemein aus dem muslimischen Kulturraum deutlich tiefer liegt als bei anderen Bevölkerungsgruppen. Mit steigendem Anteil dieser Bevölkerungsgruppen sinkt die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsquote.
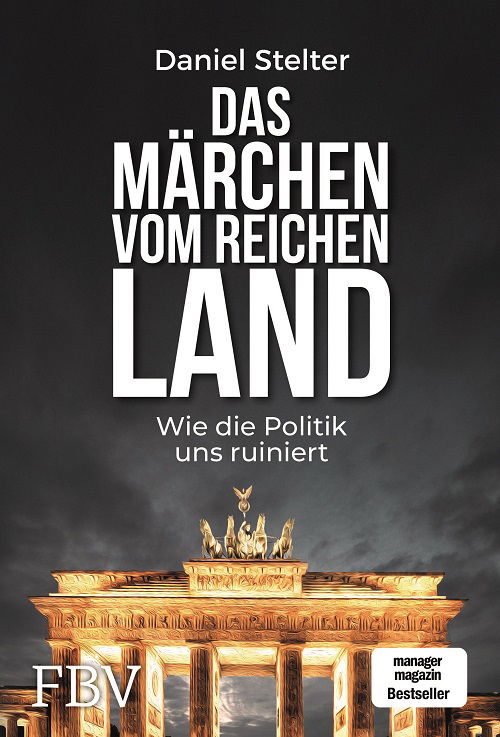
Das ist schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung, die Integration und damit für die Akzeptanz weiterer Zuwanderung nach Deutschland. Nachzuholen, was über Jahrzehnte verschleppt wurde, ist eine Herkulesaufgabe. Im Grundsatz sollte bei Zuwanderern gelten, dass sie nur dann staatliche Leistungen erhalten, wenn sie an Sprachkursen und Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen und ansonsten gemeinnützige Tätigkeiten ausführen. 35 Stunden pro Woche wären die Zuwanderer damit verpflichtend beschäftigt, solange sie öffentliche Gelder erhalten.
Steuerung der Zuwanderung
Diese Maßnahmen dürften bereits helfen, die Attraktivität Deutschlands für jene Migranten, die auf eine Einwanderung in den Sozialstaat hoffen, zu senken. Angesichts des absehbar weiter steigenden Migrationsdrucks aus dem afrikanischen Raum brauchen wir auf europäischer Ebene einen wirksamen Schutz der Außengrenze. Dieser Schutz wird anfangs zu den von den Politikern so sehr gefürchteten »schlimmen Bildern« führen, ist aber die logische Konsequenz, wenn wir unseren Sozialstaat erhalten wollen. Schon der Nobelpreisträger Milton Friedman wusste, dass ein Sozialstaat und offene Grenzen nicht kompatibel sind. Entweder man ist offen für jeden, dann aber ohne Transferzahlungen, oder aber man begrenzt die Zuwanderung und kann sich ein nationales Transfersystem leisten. Die weitgehende Aufgabe eines wirksamen Grenzschutzes ist gleichzusetzen mit einer Teilung unseres Wohlstandes mit dem Rest der Welt und perspektivisch einem brasilianischen Szenario von extremer Spaltung und hoher Kriminalität.
Erhöhung der Attraktivität für Spitzenleister
Wir müssen dringend attraktiver für Spitzenleister werden, denn sie werden auch von vielen anderen Ländern umworben. Das beginnt damit, die eigenen Spitzenleister im Land zu halten! Während die Medien sich an der Zuwanderungswelle berauschen, geht die erschreckende Tatsache unter, dass seit Jahren rund 200 000 Menschen das Land jährlich verlassen. Darin mag der eine oder andere abgelehnte Asylbewerber enthalten sein, überwiegend dürfte es sich jedoch um Qualifizierte handeln, die im Ausland eine günstigere Perspektive sehen. Erstaunlicherweise sind keine Daten zu Bildung und Einkommen der Auswanderer zu bekommen. Diese sollten ab sofort systematisch erfasst werden, damit das Thema entsprechend auf die Agenda der politischen Diskussion kommt.
Um die Attraktivität für Spitzenleister zu erhöhen, bedarf es eines ganzen Bündels an Maßnahmen: einer deutlichen Senkung der Abgabenbelastung durch eine Umstellung des Steuer- und Abgabensystems, einer Qualitätssteigerung der hiesigen Universitäten, um auch hier Spitzenstudenten zu halten, und der Förderung von Zukunftstechnologien durch eine offenere Haltung.
In Bildung investieren
Dies wird aber nicht genügen. Wir müssen gleichzeitig die Rate der Produktivitätssteigerung wieder erhöhen und damit das BIP pro Kopf steigern. Im Kern geht es dabei um ein Bündel an Maßnahmen, die alle dazu dienen, dass jeder Erwerbstätige mehr erwirtschaftet. Was nach herzlosem Kapitalismus klingt, ist nichts anderes als eine zwingende Notwendigkeit, wollen wir wenigstens einen Teil unserer Versprechen für Renten und Pensionen erfüllen und den Schaden aus der verfehlten Politik begleichen.
Erster Ansatzpunkt zur Steigerung der Produktivität ist ein besseres Bildungsniveau der Bevölkerung. Wir haben gesehen, dass die Verschlechterung der Arbeitskräftequalität in den letzten Jahren bereits dämpfend auf die Produktivitätszuwächse gewirkt hat.
Es muss also darum gehen, die Bildung wirklich zu verbessern und nicht nur den gemessenen Bildungserfolg in der Anzahl der Abiturienten und der Zahl der 1,0-Zeugnisse. Letzteres lässt sich leicht durch ständiges Absenken der Anforderungen erreichen, wie es unsere Politiker in den letzten Jahrzehnten vorgemacht haben. Damit muss Schluss sein.
Damit nicht genug. Wir sollten auch das lebenslange Lernen fördern. In Singapur beispielsweise bekommt jeder Erwachsene über 25 Jahre pro Jahr einen Gutschein über 500 Singapur Dollar (rund 320 Euro), die für Fortbildung verwendet werden können. Im Angebot sind mehr als 10 000 verschiedene Kurse im Rahmen des »SkillFuture«-Programms. Eine sicherlich bessere Mittelverwendung als die einfache Erhöhung von Sozialtransfers.
Infrastruktur und Forschung
In die gleiche Kategorie gehören die überfälligen Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Forschung. Statt unsere Straßen weiter verfallen zu lassen und in der digitalen Infrastruktur einen der hintersten Plätze zu besetzen, müssen wir ein umfassendes Programm starten, um Deutschland innerhalb von zehn Jahren zum modernsten Industrieland der Welt zu machen. Wie sonst soll eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung in der Lage sein, das BIP pro Kopf zu steigern?
Die Notwendigkeit, hier rasch umzusteuern, ist so offensichtlich, dass man sich nur darüber wundern kann, dass unsere Politiker es nicht schon längst tun! Die Angst vor den Protesten beim Einschränken von Sozialtransfers überwiegt und zeigt, wie wenig es den Verantwortlichen wirklich um Zukunft und Nachhaltigkeit geht.
Automatisierung und Digitalisierung
Ohnehin liegt der entscheidende Hebel zur Steigerung der Produktivität in neuen Technologien. Selbstfahrende Autos, die Digitalisierung von Prozessen und die zunehmende Automatisierung stellen eine enorme Chance gerade für Deutschland dar. Während in der öffentlichen Diskussion immer auf die massive Vernichtung von Arbeitsplätzen verwiesen wird – in vielen Bereichen dürften mehr als 50 Prozent der Stellen wegfallen, in einigen sogar alle –, ist es doch gerade bei uns nicht das Problem!
Diese technologische Revolution ist nur dann eine Bedrohung, wenn man einen Wegfall von bestehenden Arbeitsplätzen fürchtet. In einer Gesellschaft hingegen, in der die Arbeitsplätze aufgrund von Alterung nicht mehr besetzt werden können, nehmen Roboter und Computer niemandem Arbeit weg. Wer den Wandel als Erster vollzieht, dürfte die Grundlage für langfristigen Wohlstand legen und der Lieferant von Automatisierungstechnik für die Welt werden.
Förderung privater Investitionen im Inland
Deutsche Unternehmen investieren zu wenig im Inland, was zu den übermäßig hohen Handelsüberschüssen beiträgt. Für die Zurückhaltung bei Investitionen gibt es vielfältige Gründe. Diese reichen von den geringeren Wachstumsraten, den unsicheren Aussichten in der Weltwirtschaft bis hin zu den absehbaren Problemen im Fachkräftebereich. Eine gesamtgesellschaftliche Initiative zur technologischen Modernisierung sollte bereits einen guten Teil der Investitionshemmnisse beseitigen. Es würde klar werden, dass unsere Politik sich wieder darum kümmern will, Wohlstand zu schaffen und zu erhalten, statt sich nur auf Umverteilung zu konzentrieren.
Denkbar ist dabei auch eine Umgestaltung der Besteuerung der Unternehmen mit dem Ziel, Investitionen zu fördern. So sollten die Abschreibungsregeln so geändert werden, dass Investitionen schneller und deutlicher steuerlich geltend gemacht werden können. Im Gegenzug könnte die Besteuerung ausgeschütteter Gewinne steigen.
Staatsfonds für Deutschland
Wir haben gesehen, dass Bürger, Staat und Unternehmen in Deutschland viel sparen und dennoch nicht ankommen. Das hat neben geringem Immobilienbesitz, der Abneigung gegenüber Aktien und dem falschen Vertrauen auf staatliche Absicherung vor allem damit zu tun, dass wir unser Geld im Ausland falsch anlegen. Schon seit Jahren wächst das Auslandsvermögen deutlich langsamer, als es die Summe der Handelsüberschüsse erwarten ließe. Alleine für den Zeitraum von 1999 bis 2017 fehlen rund 600 Milliarden Euro. Besser wäre es, die Ersparnisse gewinnbringend anzulegen.
In Deutschland könnte ein Fonds Infrastrukturinvestitionen finanzieren und so dazu beitragen, den Handelsbilanzüberschuss zu verringern. Die Rendite des deutschen Auslandsvermögens wäre deutlich höher und zugleich würden wir weniger Gefahr laufen, unser Geld wie in der Vergangenheit zu verlieren.
Modernisierung des Staates
Einer der unproduktivsten Bereiche der Wirtschaft ist der öffentliche Sektor, weshalb es sich gerade hier lohnt, zu investieren. Nicht nur ist die Bürokratie eine wesentliche Belastung für den Privatsektor, auch die Arbeit der Verwaltung selbst ist wenig effizient und effektiv organisiert. Ziel muss sein, den Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Sektor zu reduzieren, damit mehr Fachkräfte der Privatwirtschaft zur Verfügung stehen. Angesichts der demografischen Entwicklung ein unerlässlicher Hebel, um das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu steigern.
Lasten gerechter verteilen
Erbschaftssteuer statt Einkommenssteuer
Deutschland hat im internationalen Vergleich ein relativ geringes Erbschaftssteueraufkommen. Umgekehrt ist die Belastung von Einkommen deutlich höher. Wie ich schon eingangs erwähnte, ist eine hohe Belastung der Einkommen eine Steuer gegen soziale Mobilität. Es ist immer schwerer, durch eigene Arbeit und Ersparnis reich zu werden. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war dies leichter, weil die Spitzensteuerbelastung erst viel später einsetzte und der Staat zusätzlich die Vermögensbildung durch Abschreibungsmodelle förderte.
Dies ist kein Plädoyer für eine Rückkehr zur staatlichen Investitionslenkung mit Abschreibungsmodellen und ähnlichen Anreizen. Im Gegenteil sollten möglichst viele der Ausnahmetatbestände abgeschafft und im Gegenzug die Einkommenssteuersätze gesenkt werden. Der Spitzensteuersatz sollte erst viel später fällig und zugleich der Freibetrag deutlich erhöht werden. Damit hätten die erwerbstätigen Menschen mehr Geld zur Verfügung, um Vermögen zu bilden. Im Gegenzug sollte eine Vermögenssteuer eingeführt und die Erbschaftssteuer reformiert werden.
Familiensplitting
Wie bereits angesprochen sollte das Einkommenssteuersystem möglichst einfach gestaltet und die vielfältigen Ausnahmebestände abgeschafft werden. Hierzu gehört auch das Ehegattensplitting, das sich als Hürde für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen herausstellt. Stattdessen sollte ein Familiensplitting eingeführt werden, das die Mittelschicht entlasten und einen deutlichen Anreiz
darstellen würde, Kinder zu bekommen. Im heutigen System ist die Belastung der Mittelschicht durch Steuern und Abgaben so hoch, dass Kinder für sie eine deutliche finanzielle Belastung darstellen. Wer also den Anteil der Kinder, die in Hartz-IV-Haushalten aufwachsen, begrenzen will, muss bereits hier ansetzen.
Loslösung des Sozialstaats von der abhängigen Beschäftigung
Auch der Sozialstaat muss mit Blick auf den Wandel in der globalen Arbeitswelt umgebaut werden. Seit seiner Erfindung basiert er auf einer Belastung des Faktors Arbeit und orientiert sich am Modell der langjährigen Festanstellung. In der neuen Welt der flexiblen Arbeitsverhältnisse und der sinkenden Bindung an einen Arbeitgeber wird das Modell zunehmend obsolet. Immer weniger Menschen leisten planbare Beiträge, immer mehr fallen durch das ursprüngliche System der Arbeitslosenversicherung und landen direkt im Bereich der Grundsicherung.
Denkt man diese Entwicklung weiter, ist die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht von der Hand zu weisen. Faktisch haben wir bereits ein bedingungsloses Grundeinkommen, allerdings ist es in der Hartz-IV-Gesetzgebung auf verschiedene Komponenten verteilt und deshalb in der Gesamthöhe wenig transparent. Wir würden zugleich die Sozialstaatsadministration deutlich vereinfachen und Arbeitskräfte für die Privatwirtschaft freisetzen.
Damit verbunden wäre die Loslösung der Finanzierung des Sozialstaates vom Faktor Arbeit:
- Die Unternehmen sollten in Zukunft keine Sozialbeiträge mehr leisten, sondern diese ausschließlich von den Arbeitnehmern
getragen werden. - Parallel werden Sozialabgaben auf allen Einkommensarten fällig, quasi als eine Sozialsteuer.
- Aus Steuermitteln wären dann keine Sozialleistungen oder Zuschüsse für Renten- und Krankenkassen mehr zu finanzieren.
Allen Bürgern wäre in jedem Monat klar, welchen Teil ihres Einkommens sie über die Sozialabgaben für soziale Solidarität
aufwenden. Das würde den Druck zur Effizienzsteigerung im Transfersystem deutlich erhöhen.
Ein gerechtes Rentensystem
Letztlich werden wir nicht darum herumkommen, das Rentensystem zu reformieren. Und zwar endlich so, dass es der demografischen Entwicklung Rechnung trägt, mit dem Ziel, die Lasten für die jüngere Generation zu begrenzen und die Erwerbsbeteiligung von Älteren zu erhöhen. Dabei müssen wir daran erinnern, dass es wohl keiner Rentnergeneration in Deutschland so gut gegangen ist wie der heutigen. Natürlich gibt es die Fälle von Altersarmut, die immer wieder durch die Medien getragen werden. Natürlich gibt es jene Menschen, die nach langer, harter Arbeit gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, einer Beschäftigung nachzugehen. Diese Fälle sind aber mehr die Ausnahme als die Regel.
Wer also gegen eine Umverteilung von »unten nach oben« ist, muss konsequenterweise das Gegenteil von dem tun, was die Sozialpolitiker in den letzten Jahren getan haben. Er muss das Renteneintrittsalter erhöhen, die Besteuerung von Vermögen einführen und im Gegenzug die Beitragszahler entlasten. Eine Umstellung der Sozialstaatsfinanzierung, wie oben diskutiert, würde dazu beitragen, dass auch die Rentnergeneration einen Beitrag zur Finanzierung leistet.
Altlasten bereinigen
Noch können wir unsere Zukunft positiv beeinflussen. Die Maßnahmen sind bekannt, und es ist eine Frage des politischen Willens und der Bereitschaft, uns einzugestehen, dass wir dem Märchen vom reichen Land aufgesessen sind. Dazu gehört auch, den Schaden, der durch die verfehlte Politik der letzten Jahrzehnte entstanden ist, zu bereinigen. Auch hier ist die Liste lang, wie wir gesehen haben. Die Energiewende muss neu gedacht werden, Investitionen müssen vor Konsum gestellt werden.
Vor allem aber geht es darum, die tickende Zeitbombe der ungelösten Eurokrise zu entschärfen:
Szenario eins: Deutschland tritt aus
Ideal wäre natürlich ein geordneter Prozess zur Neuaufstellung einer in sich harmonischeren Eurozone. Dazu müsste Deutschland aus dem Euro austreten.
Dieses Szenario ist sehr unwahrscheinlich, aber nicht völlig undenkbar. Richtig ist, dass Italien, Frankreich, Spanien und Portugal ohne uns viel leichter eine gemeinsame Wirtschaftspolitik betreiben könnten als mit uns. Dazu genügt ein Blick auf die Indikatoren der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben deutlich mehr mit Großbritannien, Schweden, Irland und den Niederlanden gemein als mit Frankreich, Italien, Spanien und Portugal.
Für Deutschland wäre es ohne Zweifel ein Schock. Allerdings müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass auch wir in Wahrheit nicht die Nutznießer des Euro sind. Die deutsche Wirtschaft würde erst einmal in eine Rezession fallen. Die Erfahrung der Vergangenheit lehrt jedoch, dass eine starke Währung die Innovationskraft und Produktivität der Wirtschaft fördert. Deshalb wären die mittelfristigen Folgen für die deutsche Wirtschaft und die Unternehmen positiv. Der Staat könnte zugleich mit Investitionsprogrammen die Konjunktur beleben.
Szenario zwei: Italien tritt aus und der Euro endet im Chaos
Weitaus unangenehmer ist das Szenario eines chaotischen Zerfalls. Das griechische Sommertheater 2015 lieferte einen Vorgeschmack darauf, wie ein chaotischer Zerfall des Euro aussehen könnte. Sobald eine eurokritische Regierung an die Macht kommt, beginnt eine massive Kapitalflucht aus dem betreffenden Land. Handelt es sich um ein großes Land, würde es rasch auch in anderen Ländern zu einer Kapitalflucht Richtung Deutschland kommen. Die EZB würde diese über Notfallkredite finanzieren, und bei der Bundesbank würden die Target2-Forderungen an die Notenbanken der anderen Länder förmlich explodieren.
Erklärt ein Land schließlich den Austritt aus dem Euro, ist es nur eine Frage der Zeit, bis weitere folgen. Erhebliche Turbulenzen an den Finanzmärkten wären die Folge. Alle Vermögenswerte dürften in diesem Szenario fallen, weil es mit erheblichen Forderungsverlusten für die Gläubigerländer, also vor allem Deutschland, verbunden ist. Die Target2-Forderungen wären über Nacht wertlos. Ein Land wie Italien beispielsweise wäre niemals in der Lage, die Verbindlichkeiten zu bedienen, egal wie sehr Mario Draghi betont, dass es das müsste. Wer pleite ist, kann nun einmal nicht zahlen.
Europa und die Welt würden in eine Rezession fallen, die Deutschland besonders hart treffen würde. Die Exporte würden einbrechen, und die Verluste auf die Forderungen ins Ausland für Versicherungen und Banken wären erheblich.
Szenario drei bräuchte politischen Mut
Die Szenarien machen deutlich, dass die Politik alles tun muss, um einen chaotischen Zerfall zu verhindern. Doch danach sieht es leider nicht aus. Die Krisenländer und Frankreich setzen auf die Sozialisierung der faulen Schulden und die massive Monetarisierung der Schulden über die EZB-Bilanz. Beides ginge zu Lasten der deutschen Steuerzahler. Die deutsche Bundesregierung spielt weiter auf Zeit und hofft auf das Wunder eines wirtschaftlichen Aufschwungs, der alle Probleme löst. Alle gemeinsam vertrauen darauf, dass die EZB weiterhin den Schuldenturm und damit den Euro vor dem Einsturz bewahrt. Auf Dauer wird das nicht funktionieren, und da die Ungleichgewichte und Forderungen mit jedem Tag größer werden, wächst auch mit jedem Tag der Schaden weiter an.
Es gibt ein weiteres Szenario: eine geordnete Schuldenrestrukturierung unter Mitwirkung der EZB und mit einem erheblichen Forderungsverzicht der Gläubiger, allen voran Deutschlands. Im Gegenzug würden echte Reformen umgesetzt und eine geordnete Neustrukturierung der Eurozone vorgenommen, indem Länder, die – wie Portugal, Griechenland und wohl auch Italien – nicht innerhalb der Eurozone prosperieren können, aus der Währungsunion ausscheiden. Es wäre eine einmalige Bereinigung der Altlasten und kein Einstieg in eine unbestimmte und unbegrenzte Transferunion, die Deutschland sich nicht leisten kann.
Weshalb sollen wir die Gläubiger retten?
Ich höre schon den Aufschrei der Kritiker: Ist es nicht ungerecht gegenüber jenen, die gespart haben? Weshalb sollen wir die Gläubiger retten? Ist die Einbeziehung der EZB nicht direkte Staatsfinanzierung mit Inflationsfolgen? Wie stellen wir sicher, dass wir nicht in ein paar Jahren wieder vor derselben Frage stehen? Warum sollte Deutschland dies tun?
Die Antwort auf die erste Frage ist leicht: Ja, es ist sogar sehr ungerecht. Aber der Schaden ist bereits entstanden und wir haben nur noch die Wahl, wie wir ihn beseitigen wollen: durch einseitige Zahlungseinstellungen der Schuldner, durch Inflationierung oder in einem geordneten Verfahren. Angesichts der Nebenwirkungen der ersten beiden Alternativen, favorisiere ich eindeutig das geordnete Verfahren.
Es ist ebenfalls richtig, dass Gläubiger wie Banken und Versicherungen profitieren. Doch auch hier gilt: Was ist die Alternative? Lassen wir die Banken die Verluste tragen, müssen wir diese wiederum mit Steuermitteln retten. Gehen wir den Weg der Beteiligung der Bankgläubiger wie in Zypern, werden auch deutsche Sparer direkt erheblich betroffen. Verlieren die Versicherungen Geld, sind es wiederum deren Kunden, die Verluste erleiden: bei Lebensversicherungen direkt, bei Sachversicherungen über deutlich höhere Prämien.
Deutschland 2030 – machbar!
Eine Kehrtwende von einem Land, das sich für reich hält, in Wirklichkeit aber arm ist, hin zu einem wirklich reichen Land für seine Bürger und mit helfender Rolle in der Welt, ist möglich. Wir müssen es nur anpacken.
Die Überlegungen, die hier dargelegt wurden, sind sicherlich nicht vollständig. Es geht um ein anderes Bewusstsein der Politik. Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit sollen zum Maßstab aller Entscheidungen werden. Dann wird klar, dass es einen Wandel geben muss. Im Großen, aber auch bei kleinen Dingen. Viele Ideen mögen radikal klingen. Sie sind es aber nicht. Sie sind nur konsequent. Radikal erscheinen sie nur dadurch, dass sie im gegenwärtigen politischen Diskurs tabuisiert und stigmatisiert werden. Das macht sie aber nicht weniger richtig.
Schon bald wird es in Deutschland gar nicht mehr möglich sein, an Morgen zu denken. Schon bei der Bundestagswahl 2017 waren 36 Prozent der Wahlberechtigten über 60 Jahre alt. 2040 werden 45 Prozent der Wahlberechtigten über 60 sein. Da diese Bevölkerungsgruppe zugleich eine höhere Wahlbeteiligung hat als die jüngere Generation, stehen wir vor einem Szenario, wo immer für Konsum und gegen Investitionen gestimmt wird. Diese Konsumhaltung wird verstärkt durch die Tatsache, dass diese ältere Generation viel weniger eigene Nachkommen hat als frühere Generationen. Was die Älteren dabei allerdings vergessen, ist die Notenwendigkeit, mindestens so viel in das Land zu investieren, dass die Wirtschaftskraft ausreicht, um die eigene Versorgung noch sichern zu können. Höchste Zeit, dass wir das tun.
Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Nutzen wir sie!
Mehr von Daniel Stelter bei DDW:
Dr. Daniel Stelter ist Makroökonom und Strategieberater. Als Autor zahlreicher Expertenbeiträge und aktueller Sachbücher liefert er einen unverstellten Blick auf die wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen unserer Zeit. Zudem ist er Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Forums beyond the obvious. Er war von 1990 bis 2013 Unternehmensberater bei der internationalen Strategieberatung The Boston Consulting Group (BCG). Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands.























Die de facto herrschende globalsozialistische Ideologie der derzeitigen Bundesregierung, die im Verein mit entfesselten Neoliberalen eine gegen die Interessen unseres Landes gerichtete Poltik macht, weist in keine gute Zukunft, da sie staatslenkende Wirtschaft betreibt. Die sogenannte Nachhaltigkeit mit all ihren moralisierenden Verpflichtungen wird hier zum Schwindeletikett einer dahinterstehenden nachhaltigen Destruktion privaten unternehmerischen Engagements. Die Anstrengungen der deutschen Wirtschaft müssen sich deshalb auf eine Wiederherstellung volkswirtschaftlicher, also nationalökonomischer Prinzipien richten, anstatt den Aktionären des Internationalismus nachzulaufen. Da liegt das Grundproblem. Welthandel kann nur funktionieren in einem Wettbewerb voneinander unabhängiger Volkswirtschaften, nicht durch ein Konglomerat monopolisierter Interessen.