
Deutschland 2040: Wir brauchen ein neues Narrativ
Eine entscheidende Voraussetzung für den dringend erforderlichen Politikwechsel hierzulande ist eine Änderung des Narrativs: Wir müssen vermitteln, dass Wohlstand die Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz ist – und nicht deren Hindernis.
Von Dr. Daniel Stelter
Das Wort »Narrativ« stammt vom lateinischen narrare ab, steht also für eine »Erzählung«. Diese Erzählung kann etwas sein, das eine Gesellschaft zusammenhält, es kann aber auch eine Erzählung sein, die den Blick auf die Realität trübt. Eine Geschichte also, die oft und variantenreich wiederholt dazu führt, dass die Menschen sie als »wahrhaftig« empfinden, obwohl sie eben nicht mit der Realität übereinstimmt. Ein Beispiel: Selbst der Spiegel sah sich bemüßigt, darauf hinzuweisen, dass die Wahrnehmung der zunehmenden Ungleichverteilung von Einkommen nicht der Realität entspricht, sondern der von den Medien betriebenen (Falsch-)Information geschuldet ist.
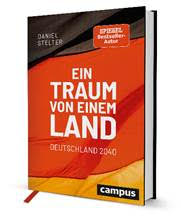
Zunehmend beherrschendes Narrativ ist die Erzählung vom Versagen des Marktes und des Kapitalismus bei der Lösung unserer Probleme. Es wird vom »Neoliberalismus« geschrieben und gesprochen, der seit Jahren in Deutschland das Sagen habe und verantwortlich sei für verfallende Infrastruktur, schlechte Schulen, den Rückstand in der Digitalisierung, die Wohnungsnot und natürlich auch den Klimawandel. Wie fraglich diese Argumentation ist, haben ich an mehreren Stellen in meinem neuen Buch gezeigt. Am offensichtlichsten ist es bei den Staatsausgaben. In den zehn Jahren vor dem Corona-Schock mangelte es der Politik nicht an Geld. Sie hat es nur lieber für höhere Sozialtransfers verwendet anstatt für Zukunftsinvestitionen. Ein Staatsanteil von rund 50 Prozent des BIP ist sicherlich kein überzeugender Beweis für die Dominanz des »Neoliberalismus« in Deutschland.
Dies hindert Ökonomen und Journalisten nicht daran zu behaupten, wir müssten endlich eine »Kehrtwende« vollziehen. Bücher werden geschrieben, Artikel verfasst und in Talkshows lauthals zitiert – auf Einladung anderer Journalisten, die genau dieses Narrativ bedienen wollen.
Dabei genügt ein kurzer Blick auf die von den Kapitalismusgegnern angeführten Beweise, um zu erkennen, dass sie eben nicht taugen, ein »Marktversagen« zu dokumentieren, sondern eher Beispiele für das Versagen von Staat und Politik sind. Beispielhaft für viele sei an dieser Stelle ein Beitrag aus Spiegel Online vom Herbst 2020 angeführt.
“Es waren falsche staatliche Interventionen, die zu den Problemen geführt haben und zu weiteren Interventionen, die die Lage noch verschlimmert haben”
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Mehrheit der Menschen es so sehen würde. Also das Narrativ gilt als Begründung für das Narrativ. Sodann führt der Autor einige Beispiele an, die unterstreichen sollen, dass die Marktwirtschaft nicht geeignet sei, die Probleme der Zeit zu lösen. Betrachtet man diese Beispiele jedoch genauer, so stellt sich heraus, dass sie nicht als Beispiele für das Versagen des Marktes taugen, sondern stattdessen für Eingriffe der Politik, die den Grundsätzen des systemischen Denkens widersprechen:
- Die Probleme der deutschen Automobilindustrie sind nicht Folge des Marktversagens, sondern der jahrelang falschen Politik in Deutschland und in der EU. Wurde zunächst vor dem Hintergrund der CO2-Emissionen die Dieseltechnologie gefördert, so kam es anschließend zu einem rasanten Kurswechsel in Richtung E-Auto. Grundproblem ist jedoch, dass die Politik den Verkehrssektor vom europäischen Emissionshandel ausgenommen hatte. Wäre dieser von Anfang an einbezogen worden, so wäre die Anpassung der Branche früher erfolgt.
- Finanzkrisen sind ebenfalls kein Beispiel für Marktversagen, sondern das Ergebnis einer falschen Regulierung – die gezielt darauf gesetzt hat, private Verschuldung zu erleichtern – und einer Notenbankpolitik, die seit Jahren »asymmetrisch reagiert« (BIZ) und damit Spekulation und Verschuldung fördert und die Vermögensungleichheit verstärkt. Die staatliche Manipulation des wohl wichtigsten Preises – der Zinsen – ist ursächlich für Überschuldung, Zombifizierung und Finanzkrisen. Das implizite Versprechen von Staaten und Notenbanken, Konkurse auszuschließen, belohnt jene, die immer mehr Risiken eingehen, und schafft die Grundlage für die nächste Krise.
- Sogar die Corona-Krise ist nach dieser Logik dem Kapitalismus geschuldet. Wenn überhaupt, dann wäre das Virus einem staatlichen Institut entfleucht – wenn man denn überhaupt in diese Richtung argumentieren will, was ich nicht tue – und keinem »kapitalistischen«. Dass Unternehmen im Privatsektor im Unterschied zum Staat nicht ewig ohne Einnahmen durchhalten, ist nun wirklich kein Beweis für das Scheitern des Kapitalismus.
- Die zunehmende Vermögensungleichheit ist ebenfalls nur zum Teil dem kapitalistischen Wirtschaftssystem geschuldet. Richtig ist, dass es in der freien Marktwirtschaft auf die individuelle Leistung ankommt, wenn es darum geht, Einkommen zu schaffen und Vermögen zu bilden. Wenn man hier Kritik üben will, dann erneut an Staaten und Notenbanken. Durch den unbedingten Willen, jede Krise auszuschließen, haben sie seit Jahren die Vermögenden »gerettet« und mit ständig sinkenden Zinsen für explodierende Vermögenspreise und zunehmende Ungleichheit gesorgt. Es waren also auch hier die falschen Eingriffe in das System, die erst zu dem Problem geführt haben.
- Am problematischsten finde ich es, wenn man die Marktwirtschaft für den Verfall von Infrastruktur und Schulen und den Rückstand bei der Digitalisierung verantwortlich macht. Es hat nicht an mangelndem Geld für den Staat gelegen, sondern an der politischen Verwendung des Geldes. Nun nach mehr Staat zu rufen ist offensichtlich falsch – es geht um einen besseren Staat!
- Ultimatives Argument gegen die marktwirtschaftliche Ordnung ist letztlich der Kampf gegen den Klimawandel. Dieser sei nur erfolgreich, wenn wir das Wirtschaftssystem fundamental ändern. Dabei ist bekannt, dass Wohlstand zu geringeren Geburtenraten führt und die Bevölkerungsexplosion der wichtigste Faktor des Anstiegs der CO2-Emissionen ist. Deshalb liegt ein Schlüssel für die Probleme darin, den weltweiten Wohlstand zu steigern. Keine Wirtschaftsordnung war bisher damit so erfolgreich wie die Marktwirtschaft. Bekannt ist auch, dass Wachstum nicht voraussetzt, dass immer mehr Ressourcen verbraucht werden. Im Gegenteil: In den zurückliegenden 40 Jahren ist es uns gelungen, den CO2-Ausstoß zu senken und das BIP pro Kopf deutlich zu steigern. Die Preise für Rohstoffe fallen seit Jahrzehnten real, obwohl die Weltbevölkerung und der Wohlstand deutlich gewachsen sind. Der Sozialismus, auch das konnten wir beobachten, war sicherlich ein schlechteres Umfeld für die Umwelt. Ein Systemwechsel ist wahrlich nicht notwendig.
“Wer angesichts eines Staatsanteils von fast 50 Prozent des BIP nicht erkennt, wo die Verantwortung für unsere Probleme liegt, will den Elefanten im Raum nicht sehen”
Was von den Gegnern des Kapitalismus als Beispiel für das Versagen des Systems ins Feld geführt wird, zeugt vielmehr vom Gegenteil. Es waren falsche staatliche Interventionen, die zu den Problemen geführt haben und zu weiteren Interventionen, die die Lage noch verschlimmert haben. Es waren unterlassene Investitionen des Staates, Rekordsteuereinnahmen zum Trotz, die zum Verfall der Infrastruktur und der Schulen geführt haben. Es war falsche Regulierung, der wir das Chaos im Klimaschutz und die rückständige digitale Infrastruktur verdanken. Es ist der Interventionismus der Notenbanken, der Ungleichheit und Zombifizierung fördert.
Wer angesichts eines Staatsanteils von fast 50 Prozent des BIP nicht erkennt, wo die Verantwortung für unsere Probleme liegt, will den Elefanten im Raum nicht sehen.
Dennoch funktioniert das Narrativ sehr gut. Ein Bekannter, der mein neues Buch in Auszügen im Entwurf gelesen hat, meinte, es sei »sehr interessant« aber doch irgendwie »wie aus den 1990ern«, ob ich denn nicht »wüsste, dass die alten Rezepte nicht taugen würden«. Dies bestärkt mich in der dringenden Hoffnung, hier gegenzuhalten. Denn nur ein Programm wie das hier dargelegte wird es uns ermöglichen, alle gesellschaftlichen Ziele zu erreichen: soziale Stabilität, Glück und eine konstruktive Rolle in der Welt. Wir sehen schon heute, wohin die Fortsetzung der heutigen Erzählung führt: in die absolute und relative Verarmung.
Zunehmend wird nicht nur in mehr staatlicher Planwirtschaft die Lösung der Probleme gesehen, sondern in einer Kultur des gezielten Verzichts. Ökonomen und Journalisten predigen mit Verweis auf den Klimawandel eine bewusste De-Industrialisierung und Verarmungspolitik. Dabei mögen die Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung heute noch wie Spinnerei klingen. In Wahrheit finden sie breite Unterstützung in den Medien.
Was dort angedacht wird, sollte uns alle aufrütteln. Nicht nur sollen demnach alle Autos mit Verbrennungsmotor schon 2035 verboten werden, sondern auch die Wohnfläche pro Kopf von den heutigen 47 Quadratmetern auf das Niveau der 1960er-Jahre mit 19 Quadratmeter gesenkt werden. Dazu sollen Bewohner »zu großer« Wohnungen diese mit Familien tauschen. In eine ähnliche Richtung gehen Überlegungen der Grünen, den Bau von Einfamilienhäusern zu verbieten und die Bevölkerung in Mehrfamilienhäusern in Städten zu konzentrieren. Ideen wie diese sind nur in einem Umfeld denkbar, das sich nicht nur von der Marktwirtschaft, sondern auch von der persönlichen Freiheit entfernt. Es ist Sozialismus, dieses Mal nicht mit dem Ziel, einen besseren Menschen zu erschaffen, sondern das Weltklima zu retten – ein Ziel, das nicht erreichbar ist, und schon gar nicht auf diesem Wege.
Dies beweist, dass eine entscheidende Voraussetzung für den dringend erforderlichen Politikwechsel hierzulande eine Änderung des Narrativs ist: Wir müssen vermitteln, dass Wohlstand die Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz ist – und nicht deren Hindernis.
Wir Bürgerinnen und Bürger sind gefordert
Dieses Ziel zu erreichen ist angesichts des medialen und politischen Dauerfeuers in Richtung staatlicher Steuerung und Planung unzweifelhaft schwer. Dabei plädiert auch dieses Buch nicht für »Neoliberalismus« und einen schwachen Staat. Im Gegenteil geht es mir um einen starken Staat im Sinne eines effektiv handelnden Staates. Die meisten verwechseln bei dem Thema »groß« mit »stark«, dabei haben wir gesehen, dass es in vielen Fällen einer starken Rahmensetzung bedarf.
“Entscheiden wir uns für eine Fortsetzung der gegenwärtigen Politik, so dürfte der Traum von einem wohlhabenden Land ein Traum bleiben”
Diese Nachricht in die öffentliche Diskussion zu bringen ist im gegebenen Umfeld nicht leicht. Umso mehr lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Die bevorstehende Bundestagswahl, von der Politik in vorhersehbarer Routine zur »wichtigsten der Geschichte« erklärt, hat in der Tat entscheidende Bedeutung. Gelingt es, die hier postulierten Ziele und Vorschläge in die Diskussion zu bringen und damit einen Kontrapunkt zum vorherrschenden Trend zu setzen, oder nicht? Entscheiden wir uns für eine Fortsetzung der gegenwärtigen Politik, so dürfte der Traum von einem wohlhabenden Land ein Traum bleiben.
Wirtschaftlicher Niedergang, soziale Konflikte und das Verfehlen aller Ziele würden unausweichlich. Fordern wir unsere Politiker also heraus! Hinterfragen wir Aussagen und Versprechen der Politik intensiver und genauer als bisher, machen wir Vorschläge, wie es besser geht. Vor allem: Sprechen wir mit unseren Mitmenschen. Nur dann, wenn die Öffentlichkeit anders (hinter)fragt, haben wir eine realistische Chance, den Traum von einem wohlhabenden Land wahr werden zu lassen. Machen Sie mit!
Mehr von Dr. Daniel Stelter auf DDW:
- Coronomics: Neustart aus der Krise
- So sanieren wir Deutschland
- Das Märchen vom reichen Deutschland – eine Quittung
Dr. Daniel Stelter ist Makroökonom und Strategieberater. Er betreibt das Diskussionsforum beyond the obvious und geht wöchentlich mit dem gleichnamigen Ökonomie-Podcast auf Sendung. Als Autor zahlreicher Expertenbeiträge und aktueller Sachbücher liefert er einen unverstellten Blick auf die wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen unserer Zeit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Zuletzt erschien von ihm »Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040«, dem dieser Beitrag entnommen ist.























Das läuft in Richtung einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft?