
Fördergelder akquirieren – der Antrag macht die Musik
Erst der Antrag, dann die Förderung. Was als Binsenweisheit erscheinen mag, ist im Bereich der Fördergelder oftmals mit enormem Aufwand verbunden. Erfahrene Berater stehen dem Unternehmer immerhin zur Seite – und müssen dies auch z.B. bei bestimmten Corona-Hilfen.
von Dr. Thomas Jesch
Bevor es überhaupt an den Antrag geht, sollte man jeweils vier Wochen für die Recherche des richtigen Programms oder der richtigen Programme einplanen – und noch einmal vier Wochen für die Ausarbeitung der Antragsunterlagen.
Im folgenden Beitrag sollen nur einige allgemeine Grundsätze und Hinweise zusammengefasst werden, mit denen sich die Erfolgschancen für einen Fördergeld-Antrag erhöhen lassen.
Wann? Zum Zeitpunkt der Antragsstellung für Fördergelder
Viele Förderprogramme schreiben vor, dass das Projekt noch nicht begonnen sein darf. Sie müssen also erst den Antrag stellen und dürfen erst dann mit dem Projekt (zum Beispiel dem Bau einer Gewerbeimmobilie, dem Kauf einer Maschine oder einem Entwicklungsvorhaben) starten – eine »Rückwärtsförderung« gibt es grundsätzlich nicht. In anderen Fällen darf man sogar erst mit der Bewilligung beziehungsweise der Erteilung eines vorläufigen Maßnahmebeginns mit dem Projekt beginnen. Ein Grund mehr, um rechtzeitig die eigene Fördergeld-Strategie zu entwickeln, damit die Förderfähigkeit eines Projektes nicht unnötig an dieser Hürde scheitert.
Allerdings kann der Unternehmer immerhin schon mit der Planung beginnen und hierfür entsprechende Experten beauftragen. Bei Beginn der Umsetzung (»Leistungsübergang«) müssen die Anträge aber gestellt sein.
Die eigene Hausbank kann im Einzelfall zum Beispiel über einen Beihilfeantrag schon in der Planungsphase sicherstellen, dass keine Fristen für Fördergelder versäumt werden.
Wie? Antragsinhalte für Fördergelder
Neben dem klassischen papiergebundenen Antragsverfahren von Fördergeldern ist oftmals bereits eine digitale Beantragung möglich, dann verbunden mit einer Registrierung im Vorfeld.
Dem Antrag vorweg gehen sollte die Projektskizze. Sie prüfen ja ein konkretes Projekt beziehungsweise eine konkrete Investition, dessen Koordinaten Sie zunächst festhalten sollten.
Eine solche Projektskizze sollte inhaltlich mindestens die folgenden Fragestellungen adressieren:
- Welches Problem will das Projekt lösen?
- Was steht für die Problemlösung bereits technisch/verfahrensseitig zur Verfügung (gegebenenfalls inklusive Schutzrechte)?
- Wer ist die Zielgruppe?
- Welches Alleinstellungsmerkmal bieten Sie der Zielgruppe?
- Wie wollen Sie die Zielgruppe erreichen (Marketing/Vertrieb)?
- Wollen Sie Partner in das Projekt einbeziehen?
- Wie sieht der zeitliche (gegebenenfalls Meilensteine) und finanzielle Rahmen des Projektes aus?
Es kann sich durchaus ein konstruktives Wechselspiel aus Projektskizze und Antrag ergeben, wenn Sie hinsichtlich einiger Antragsvoraussetzungen Flexibilität besitzen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, während andere Projektbestandteile feststehen. Manche Gegebenheiten stehen einem erfolgreichen Antrag von vornherein entgegen. So wird es regelmäßig nicht sinnvoll sein, den Unternehmensstandort zu verlagern, um in den Genuss einer Förderung zu kommen. Dagegen herrscht bei einem jungen Technologieunternehmen gegebenenfalls Flexibilität dahingehend, solche Digitalisierungsvorhaben bevorzugt voranzutreiben, bei denen eine Förderung gewährt wird.
Vollständige Unterlagen
Informieren Sie sich rechtzeitig darüber, welche Unterlagen Sie für Ihren Antrag benötigen. Ein gelegentlicher (telefonischer) Kontakt zur zuständigen Stelle dürfte nicht nur in dieser Hinsicht förderlich sein.
Bemühen Sie sich um Vollständigkeit. Kosten, die bei der Antragstellung vergessen wurden, können bei Gewährung der Mittel nicht mehr berücksichtigt werden.
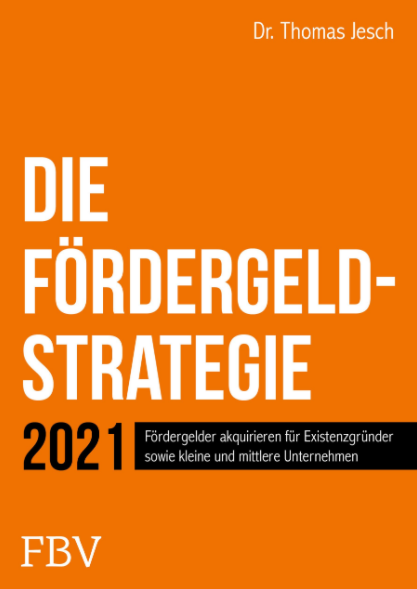
Die meisten Fördergelder sind an bestimmte Bedingungen geknüpft, welche das Projekt des Unternehmens erfüllen muss. Viele Programme führen diese in entsprechenden Förderrichtlinien auf. Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre, eine Liquiditätsplanung für die nächsten zwölf Monate unter verschiedenen Szenarien und zudem – programmabhängig – eine Risikoprüfung müssen vorliegen.
Förderrichtlinien dienen der konkreten Implementierung der Förderinstrumente.
Überhaupt gilt: oftmals ist es nicht der eine Antrag, womöglich müssen auch fünf oder sechs Anträge parallel vorbereitet werden, was auch in zeitlicher Hinsicht berücksichtigt sein will. Hier kann die Unterstützung eines Fördermittelberaters wertvoll sein. Entsprechende Angebote und Referenzen sollten rechtzeitig eingeholt werden.
Originäre EU-Programme boten viele Jahre lang relativ abschreckende Antragsprozeduren, hier hat sich aber auch auf Intervention der EU-Kommission viel getan.
Falschangaben in den Anträgen können strafrechtliche Folgen haben. Also: redlich und genau sein, auch in schwierigen Zeiten.
Ist dokumentarisch mit dem Antrag alles erledigt? Bei einer Fremdkapitalfinanzierung müssen Unternehmen den Nachweis erbringen, dass die Gelder fördergerecht verwendet werden. Bei einer Eigenkapitalfinanzierung kommt ein regelmäßiges Reporting hinzu. Eine Einmischung der Förderstelle in das operative Geschäft dürfte die große Ausnahme sein.
Nicht zuletzt der Bundesrechnungshof hat ein Interesse an detaillierten und vom Fördergeber sorgfältig kontrollierten Verwendungsnachweisen. Hier gab es im Bereich der Fördergelder in der Vergangenheit schon einige Streitereien. So ist zum Beispiel im Rahmen der GRW-Förderhilfen im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung zu belegen, dass die neu geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätze tatsächlich nach fünf Jahren noch vorhanden sind.
Wo? Ihr Ansprechpartner
Sie müssen sich vergewissern, dass ihr Antrag auch bei der richtigen Förderstelle eingereicht wird, schon um vorgegebene Fristen zu wahren. Auch ist es sinnvoll, den Ansprechpartner in Person schon vorab hinsichtlich entsprechender Rückfragen zu identifizieren. Ein persönliches Gespräch mit einem Projektträger ist in der Regel auch von diesem frühestmöglich gewünscht.
Unter welchen Umständen? Erwägung einer Antragsrücknahme?
Auch ohne negativen Bescheid kann das Unternehmen in eine Situation kommen, in der sich eine Antragsrücknahme empfiehlt. Bei KfW-Krediten kann sich schlicht die Situation ergeben, dass deren Notwendigkeit aufgrund einer positiven Geschäftsent-wicklung in der Zwischenzeit entfallen ist.
Auch ist womöglich eine der Hausbanken nicht mit den von der KfW geforderten Anpassungen einverstanden. So kann zum Beispiel eine von der KfW geforderte vorrangige Besicherung von einer Hausbank abgelehnt werden. Umgekehrt kann auf Unternehmensseite die Ausschüttung einer Mindestdividende verpflichtend sein, was bei Inanspruchnahme eines KfW-Kredits untersagt ist.
Was? Wartefristen, Liquidität und Bescheid
Von der Antragsstellung bis zum Bescheid und der Auszahlung kann mitunter einige Zeit vergehen. Zumindest mit einigen Wochen sollten Sie rechnen, sechs Monate Bearbeitungszeit sind bei einigen Programmen durchaus üblich. Das sollten Sie berücksichtigen, um bereits getätigte Investitionen nicht zwischenfinanzieren zu müssen. Darüber hinaus gibt es bei vielen Förderprogrammen die Bedingung, dass mit dem geförderten Projekt noch nicht begonnen werden darf, solange das Darlehen nicht ausgezahlt wurde. Weiterhin kann ein positiver Bescheid an bestimmte Auszahlungsvoraussetzungen geknüpft werden, für deren Herstellung gegebenenfalls eine weitere zeitliche Reserve einzuplanen ist.
Zu beachten ist, dass oftmals ein zweistufiges Entscheidungsverfahren einschlägig ist, bei dem zunächst über die grundsätzliche Förderfähigkeit des Vorhabens entschieden wird und danach noch einmal, ob die Förderung wirklich bewilligt werden kann.
Und dann kann es sein, dass der Förderantrag abgelehnt wird. Dann ist ein Widerspruch zu prüfen oder ein neuer Antrag, in einem anderen Programm oder für eine andere Förderperiode, zu stellen.
Wer? Verantwortliche für die Mittelverwendungskontrolle
Bei Verletzung der Förderrichtlinien drohen Rückzahlungs- und Verzinsungsansprüche der Fördermittelgeber. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn keine sachgerechte Mittelverwendungskontrolle stattgefunden hat. Zu beachten sind gegebenenfalls die KfW-Anforderungen an den zweckentsprechenden und fristgerechten Mitteleinsatz.
Und nun: an den Antrag mit Entschlossenheit und Zuversicht – im schlechtesten Fall gewinnen Sie an Wissen, bestenfalls aber erhalten Sie eine Liquiditätsspritze, die in diesen Zeiten überlebenswichtig sein kann.
Dr. Thomas A. Jesch ist geschäftsführender Vorstand des Bundes Institutioneller Investoren mit Sitz in Frankfurt am Main. Er ist zudem Verfasser der „Fördergeld-Strategie 2021“, die soeben im FinanzBuch Verlag erschienen ist. Bei dem Text handelt es sich um ein
gekürztes und leicht überarbeitetes Teilkapitel aus diesem Werk.























Schreibe einen Kommentar