
Der Erbfaktor
Erben ist, wenn einer hinterlässt, also gibt, und andere vererbt bekommen, also nehmen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Erben ist in vielen Fällen eher Soll als Haben, eher Last als Lust, eher Druck als Entspannung. Kerstin Schubert hat diese Erfahrungen machen müssen, als sie nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, Christoph Schubert, die Führungsverantwortung des Gebäudedienstleisters Schubert Gruppe von heute auf morgen übernehmen musste. Ihre Erfahrungen hat sie jetzt in einem Buch beschrieben.
Von Kerstin Schubert
Mit einer Erbschaft werden nicht nur Vermögenswerte übertragen, sondern auch »Defizite« auf der Beziehungsebene: Unachtsamkeit bei den Erbregelungen, Misstrauen gegenüber Familienangehörigen, irrige Rollenzuschreibungen, überzogene Harmoniebedürfnisse, enttäuschte Erwartungen, familiäre Missverständnisse oder konträre Gerechtigkeitsvorstellungen. Erben ist in vielen Fällen also eher Soll als Haben, eher Last als Lust, eher Druck als Entspannung.
Kaum eine familiäre Angelegenheit ist mit mehr ambivalenten Gefühlen verbunden als das Vererben und das Erben. Schon das Verfassen des Testaments ist für den Erblasser eine emotionale Herausforderung. Die Beschäftigung mit dem letzten Willen führt automatisch zur Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit – mit Tod, Verlust, Trauer und Schmerz, aber auch mit Entmachtung, Kontrollverlust und Zerfall.
Eine Erbschaftsregelung zu treffen ist ein psychisch hochbrisantes Thema, das oft verdrängt oder vor sich hergeschoben wird. Laut einer Emnid-Umfrage haben gut 70 Prozent aller Deutschen zwischen 50 und 59 Jahren kein Testament hinterlegt. Bei den über 60-Jährigen trifft das noch auf die Hälfte der Befragten zu. Selbst wenn eine letztwillige Verfügung vorliegt, erweist sie sich nicht selten als unklar, widersprüchlich oder gänzlich unwirksam.
Mehr als 70 Prozent aller Deutschen haben kein Testament hinterlegt
Die Planung der Erbschaft ist ein Tabuthema, dem viele am liebsten aus dem Weg gehen möchten. Und wenn das Aufsetzen des Testaments dann doch ansteht, soll der Prozess so kurz und lautlos wie möglich über die Bühne gehen.
Das Testament wird als Geheimkommando im stillen Kämmerchen verfasst. Zurate gezogen werden allenfalls Steuer- oder Vermögensberater, Anwälte oder Notare. Im Familienkreis hingegen gilt die offen ausgesprochene Frage, ob und wie die Verteilung des Familienvermögens geregelt werden soll, als nahezu respektlos und unanständig. Deshalb findet eine Diskussion der Familienangehörigen über das Für und Wider der Vermögensverteilung nur selten statt.
Die Folge dieser »Sprachlosigkeit« sind Erbregelungen, die schwer nachvollziehbar sind und von den Erben oft als ungerecht oder bevormundend empfunden werden.
Viele Erblasser glauben dennoch, dass sie alles bis ins Detail und zur Zufriedenheit aller geregelt haben. Ihnen ist einfach nicht bewusst, wie viele emotionale Irrungen und Wirrungen bei der Nachlassregelung mit im Spiel sind.
Bei einer Erbschaft geht es immer um weit mehr als nur um Geld. Oberflächlich betrachtet bekommen die Erben ein »leistungsfrei« erworbenes Vermögen. Doch fast immer ist das Erbe mit Erwartungen an seine Empfänger verbunden. Die Lebensleistung des Erblassers soll gewürdigt und erhalten werden. Das hart und entbehrungsreich erarbeitete Vermögen soll vor der möglichen Verschwendung durch die Erben geschützt werden. Und Streitigkeiten innerhalb der Familie sollen unbedingt vermieden werden.
Diese Wünsche und Erwartungen des Erblassers führen zu testamentarischen Regelungen, die sicherstellen sollen, dass 10 sein Einfluss auf das Verhalten der Erben weit über seinen Tod hinaus erhalten bleibt. Der lange Arm des Erblassers greift dann mitunter empfindlich in die Selbstbestimmung und die Handlungsfreiheit der Erben ein – etwa durch die Berufung eines Testamentsvollstreckers, der jahrzehntelang seine Hand auf die Erbschaft halten kann.
Gegenüber diesen Nachlasshütern sind die Erben nahezu machtlos. Und nicht selten müssen sie erleben, dass der Testamentsvollstrecker seine ihm vom Erblasser überantwortete Macht zur eigenen Bereicherung missbraucht.
Die emotionale Dimension des Erbes
»Das Testament des Verstorbenen ist der Spiegel der Lebenden«, lautet ein polnisches Sprichwort und trifft die Wahrheit im Kern.
Die letztwillige Verfügung ist Ausdruck der Wertschätzung des Erblassers für seine Nachkommen. Mit dem Testament kann er seinen Respekt und sein Vertrauen gegenüber den Erben ausdrücken oder auch sein Misstrauen und seinen Herrschaftsanspruch.
Diese emotionalen Dimensionen des Erbes mitsamt ihrer weitreichenden Folgen waren mir bis zum Tod meines Vaters nicht bewusst. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, mit welcher Wucht der Tod eines einzigen Menschen das Leben der Hinterbliebenen verändern kann.
Das Testament ist Ausdruck der Wertschätzung des Erblassers für seine Nachkommen
Eigentlich sollte das Testament meines Vaters sicherstellen, dass das Leben seiner Familie auch nach seinem Tod in geordneten Bahnen verläuft. Eingetreten ist das Gegenteil.
Als ich das erkannte, haderte ich damit, dass mein Vater als erfolgreicher Unternehmer diese Fehlsteuerungen bei der Verfassung seines Testaments nicht bemerkt hat. Ich brauchte Zeit und Abstand, um zu erkennen, welche komplexen Dynamiken zu dieser Situation beigetragen haben. Heute blicke ich versöhnlicher und klarer zurück auf meine Irrfahrt durch die vielen Instanzen der Erbschafts- und Nachfolgeregelungen.
Mit meinem Buch möchte ich die Leser an meinem Lernprozess teilhaben lassen, damit sie als Erben die Möglichkeit einer günstigeren Ausgangslage haben als ich. Mein Buch versteht sich als Beginn einer Beratung, die dort ansetzt, wo andere aufhören: an der Selbstreflexion der Erben und Erblasser – an der Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, Erwartungen, Haltungen und Hoffnungen, jenseits der rationalen Dimension der Vermögensverteilung.
Als Tochter und Unternehmerin in einem mittelständischen Familienunternehmen kenne ich das Spannungsfeld zwischen Familie und Unternehmen in all seinen emotionalen und rationalen Facetten.
Aus eigener Erfahrung weiß ich um die Risiken und Stolpersteine, die sich aus dem Konstrukt des Familienunternehmens ergeben. Und ich habe erlebt, wie kompliziert die Lage wird, wenn eine Nachfolgeregelung im eigenen Familienunternehmen plötzlich und unerwartet nötig wird. Ich hoffe, dazu beitragen zu können, dass die Scheu vor dem offenen und ehrlichen Dialog über Erbschaftsfragen im Familienkreis abgebaut wird. Wer diesen Verständigungsprozess als Posten auf der Habenseite eines Erbes verbuchen kann, hat schon viel gewonnen.
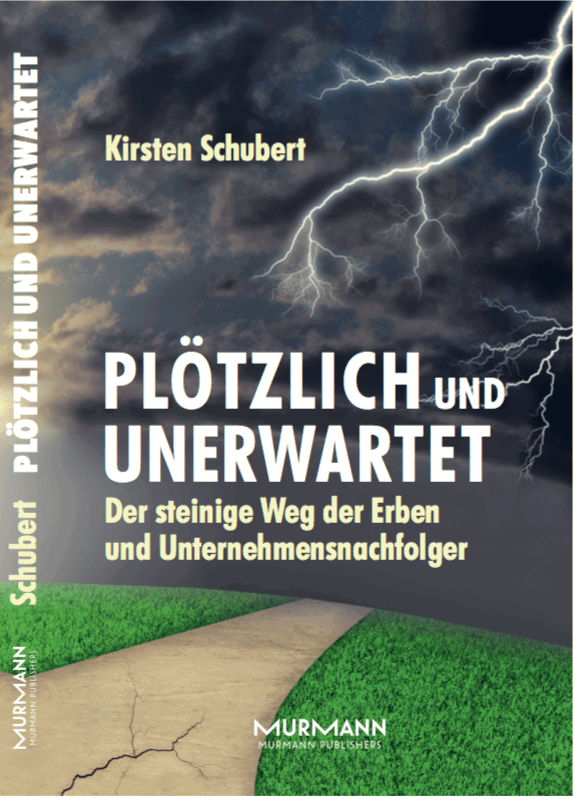
„Plötzlich und unerwartet – der steinige Weg der Erben und Unternehmensnachfolger“
Ist beim Murmann Verlag erschienen. Auf 200 Seiten erfahren Sie mehr über den entscheidenden Erbfaktor, Spielregeln in Familienunternehmen und Persönlichkeitsmerkmale eines Patriarchen. Ich spreche über Stillstand und Rückstand, aber auch über die Möglichkeit, aus schlechten Erfahrungen neue, positive Perspektiven zu entwickeln.
Bestellmöglichkeit: www.ploetzlich-und-unerwartet.com
Kerstin Schubert war Gesellschafterin und Sprecherin der Geschäftsführung der Schubert Gruppe, bis diese in die WISAG aufging. Heute betreibt Kerstin Schubert mit der Düsseldorfer reef Consulting Organisations-, Chance- und Nachfolgeberatung.
















Schreibe einen Kommentar