
Wachstum versus Gewinn: Eine Prognose bis 2050
„Wachstum versus Gewinn“ – unter diesem Dachthema stand die 30-jährigen Jubiläumskonferenz der Beratungsgesellschaft Simon-Kucher & Partners, an der mehr als 1000 Unternehmer und Manager teilnahmen. Professor Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon hielt zu diesem Anlaß eine vielbeachtete Rede über Wachstumsszenarien und Gewinnperspektiven, die Die Deutsche Wirtschaft hier dokumentiert. China und Deutschland werden im weltweiten Wachstum Sonderrollen einnehmen, so Professor Simon. Unter anderem geht er im Gegensatz zu offiziellen Schätzungen wegen der dramatisch steigenden Zahl von Einwanderern von einem massiven Bevölkerungswachstum von rund 20 Millionen Menschen bis 2050 in Deutschland aus. Wird diese Einwanderung bewältigt, kann Deutschland über Jahrzehnte ein wachsender Markt sein. Misslingt die Integration, dürfte Deutschland verarmen.
Sehen Sie zu diesem Beitrag auch die Charts: Wachstum unlimited
Die Balance zwischen diesen beiden Zielgrößen „Wachstum versus Gewinn“ stellt Unternehmensführer ständig vor neue Herausforderungen. Zum einen geht es dabei um makroökonomische Größen. Wenn beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt eines Landes nicht oder nur gering wächst, bedeutet dies, dass ungefähr die Hälfte der Firmen in diesem Land schrumpft und die meisten anderen Unternehmen ebenfalls ein eher bescheidenes Wachstum erreichen. Ganz anders sieht es in Schwellenländern aus. Bei Wachstumsraten von 5 Prozent oder mehr kann die Mehrzahl der Unternehmen in ihren Umsätzen zulegen. Allerdings ist zu hohes Wachstum auch gefährlich, denn Finanzierung und Mitarbeiterstamm müssen mithalten. Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene stellt sich die Frage nach der Balance von Wachstum und Gewinn im Internetzeitalter verschärft. Wir erleben Fälle wie beispielsweise Amazon oder Salesforce.com, die mittlerweile seit Jahrzehnten stark wachsen, ohne jemals einen nennenswerten Gewinn erzielt zu haben. Dennoch bewertet die Börse diese Unternehmen hoch, das ist ein neuartiges Phänomen.
Wachstum: Superoptimisten und Skeptiker
Die Sicht auf die zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten ist äußerst geteilt. So schreibt die führende französische Zeitung Le Monde am 3. September 2015: „Das Leben ohne Wachstum ist das Schicksal der Industrieländer. Die Stagnation resultiert aus dem Abflachen des technischen Fortschrittes und der Überalterung der Bevölkerung. Diese wachstumspessimistische Sicht, man spricht auch von säkularer Stagnation, hat berühmte Anhänger. Beispiele sind Daniel Cohen von der führenden französischen Universität École Normale Supérieure, Meinhard Miegel aus Deutschland mit seinem Buch „Exit“, Larry Summers, der frühere amerikanische Finanzminister und Harvard-Präsident, oder Professor Robert Gordon von der Northwestern University. Als Gründe für die pessimistische Sicht auf das Wachstum werden neben den in Le Monde erwähnten Faktoren wie Abflachen des technischen Fortschrittes und Überalterung der Bevölkerung in den Industrieländern, die Umwelt, die Erschöpfung der Ressourcen, das Internet sowie die aus ihm entstehende Null-Grenzkosten-Gesellschaft genannt. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei die Sharing Economy, die dazu führen wird, dass private Kapazitäten wie Wohnräume oder Autos stärker genutzt und damit die Wachstumsperspektiven der Hotel- und der Automobilbranche reduziert werden.
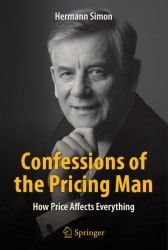
Aber das ist nur die eine Seite. Genauso berühmte und zahlreiche Experten findet man am wachstumsoptimistischen Ufer. Die prominenteste Gesetzmäßigkeit ist Moore’s Law, dem zu Folge sich die Kapazität von Mikrochips alle 18 bis 24 Monate verdoppelt. In der Tat hält dieses berühmte Gesetz seit mittlerweile 50 Jahren und ein schnelles Auslaufen ist nicht in Sicht. Zahlreiche Autoren, wie Peter Diamandis und Steven Kotler in ihrem Buch „Abundance“, prognostizieren eine Zeit des Überflusses. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Automatisierung, die insbesondere von Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee vom Massachusetts Institute of Technology in ihrem Buch „The Second Machine Age“ propagiert wird. Noch weiter gehen die Autoren Nick Bostrom und Michael Anissimov in ihrem Buch „Superintelligence“. In einigen Jahrzehnten erwarten sie Maschinen, die intelligenter sind als die Menschen und enorme Wachstumssprünge erzeugen sollen. Auch Investoren und Unternehmer wie Peter Thiel in seinem Buch „Zero toOne“ oder ElonMusk, dessen Biografie „Tesla, SpaceX, andthe Quest for a Fantastic Future“ betitelt ist, erwarten rosige Wachstumszeiten.
Persönlich neige ich eher zu der wachstumsoptimistischen Seite, wobei es allerdings meistens etwas länger dauert als von den Superoptimisten vorhergesehen.
Wachstum bis 2030
Wie wird die Welt bis 2030 wachsen? China wird in den nächsten 15 Jahren den mit Abstand größten Wachstumsbeitrag leisten. Aber auch die USA und die Europäische Union werden stark wachsen. Enttäuschend fällt hingegen der Wachstumsbeitrag der übrigen BRIC-Länder Russland, Indien und Brasilien aus. Das liegt daran, dass diese Länder zwar relativ hohe Wachstumsraten erzielen, aber die Ausgangsbasis niedrig ist. Die Welt wird sich in eine erste und eine zweite globale Liga aufteilen. Zur ersten Liga gehören die USA, die Europäische Union und China. Die Länder in der zweiten Liga haben wirtschaftlich weit geringere Gewichte. Wer im globalen Markt eine Rolle spielen will, muss also in der ersten globalen Liga stark sein.
Wachstum bis 2050
Das Jahr 2050 scheint sehr fern, aber es ist nicht weiter weg als 1980. In diesem Zeitraum wird die Demographie zum bestimmenden Faktor. Nimmt man die offizielle Prognose der UNO (Index 100 = 2010), so sieht man, dass die Bevölkerung in Afrika in den nächsten 35 Jahren explosiv wächst. Sie wird sich von etwa 1 Milliarde heute auf deutlich über 2 Milliarden erhöhen. Auch die übrigen islamischen Länder wachsen sehr stark, während Europa, Japan und Russland nach dieser offiziellen UN-Prognose schrumpfen. Auf Deutschland bezogen bin ich allerdings anderer Meinung. Statt der UNO-Prognose von 73 Millionen in 2050 erwarte ich 93 Millionen. Der UNO-Prognose geht von einer Nettozuwanderung von 200.000 Menschen pro Jahr aus. Ich erwarte eher 800.000. Die Differenz von 600.000 pro Jahr ergibt in 35 Jahren rund 20 Millionen mehr. Dabei ist die zugrunde liegende Zahl für 2015 nur vorläufig und wird wohl noch höher ausfallen.
Massives Bevölkerungswachstum für Deutschland
Deutschland wird ein massives Bevölkerungswachstum erleben und sein Gewicht in Europa wird zunehmen. Gebiete wie das Ruhrgebiet oder Ostdeutschland, die heute Einwohner verlieren, werden wieder besiedelt. Aus diesem Bevölkerungswachstum und der Fremdheit der Zuwanderer erwachsen gigantische Herausforderungen für Integration und Bildung. Falls wir diese bewältigen, wird Deutschland über Jahrzehnte ein wachsender Markt sein. Misslingt die Integration, dürfte Deutschland verarmen.
Ähnliche Wachstumserwartungen gelten auch für Europa. Diese geht allerdings mit internen Verschiebungen einher. Wir erleben eine Migration von Ost nach West sowie von Süd nach Nord. Es ist davon auszugehen, dass der europäische Norden den Süden permanent subventionieren muss.
These 1
Mit hoher Wahrscheinlichkeit steht die Welt vor einer Phase weiterhin starken Wachstums. Die zukünftigen Pole der globalen Wirtschaft werden die USA, die EU und China sein. Alle anderen Länder spielen in der zweiten globalen Liga. Afrika wird eine zunehmend wichtige Rolle spielen – mit ungewissen Perspektiven. Europa und Deutschland sind Wachstumsregionen, innerhalb derer sich die Gewichte allerdings deutlich verschieben.
Was wächst am stärksten?
Stärker als alle Bruttoinlandsprodukte wächst der internationale Warenaustausch. Vor 100 Jahren lagen die globalen Pro-Kopf-Exporte nahe an Null. Es dauerte 80 Jahre, sie auf 437 Dollar zu bringen. In den 20 Jahren von 1980 bis 2000 hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt und in den letzten 14 Jahren nahezu verdreifacht. Das sind wohl gemerkt die Pro-Kopf-Exporte, hinter denen 1900 eine Weltbevölkerung von 1,6 Milliarde Menschen stand. Heute sind es 7,3 Milliarden. In absoluten Zahlen sind die Weltexporte ungefähr um das 2000-fache höher als vor gut 100 Jahren.
Wie schneiden einzelne Länder in diesem stark wachsenden Weltmarkt ab? Es wird sichtbar, dass Deutschland eine extreme Ausreißerposition besetzt. Die deutschen Pro-Kopf-Exporte sind rund doppelt so hoch wie die der großen europäischen Nachbarländer, die ja geostrategisch eine ähnliche Lokation besitzen.
Hier ist eine Anmerkung angebracht. Man spricht immer von Exporten eines Landes. In Wirklichkeit exportieren Deutschland oder andere Staaten nicht. Nur Unternehmen exportieren, und zwar nur die stärksten Unternehmen, also diejenigen, die international wettbewerbsfähige Produkte zu vernünftigen Preisen anbieten können. Dies lässt folgenden Umkehrschluss zu: Wenn ein Land im Export stark ist, muss es viele international wettbewerbsfähige Unternehmen haben. Nun liegt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei vor allem um Großunternehmen handelt, die Exportstärke eines Landes also von Großunternehmen abhängt.
Ausnahmeländer Deutschland und China
Für die meisten Länder erkennt man tatsächlich eine fast lineare Korrelation zwischen diesen Größtunternehmen und den Exporten. Aber es gibt zwei Ausnahmen: China und Deutschland. Genau diese beiden Länder wiesen im Zeitraum 2005-2014 die größten Exporte auf. Worin unterscheiden sich China und Deutschland vom Rest? Es ist die Rolle mittelständischer Exporteure. Von den chinesischen Exporten kommen 68 Prozent aus Unternehmen mit weniger als 2000 Mitarbeitern. In Deutschland stammen zwei Drittel der Exporte von mittelständischen Unternehmen. Um exportstark zu sein, braucht ein Land Großunternehmen, aber das allein reicht nicht aus. Es muss ein exportstarker Mittelstand hinzukommen, um ein Land an die Spitze der Exportstatistik zu katapultieren.
Was treibt das Wachstum? Welche Faktoren stehen dahinter? Es sind vor allem Innovationskraft, eine starke Produktionsbasis und konkurrenzfähige Lohnstückkosten. Deutschland bekleidet eine herausragende Position bei diesen Faktoren.
These 2:
Der internationale Warenaustausch wächst stärker als einzelne Volkswirtschaften. Viele deutsche Unternehmen sind gut aufgestellt, diese Wachstumschancen zu nutzen.
Innovationskraft, eine starke Produktionsbasis und Kosten-wettbewerbsfähigkeit sind die Grundlagen für anhaltenden Wachstumserfolg.
Wer wächst? Wer schrumpft?
Hinter diesem positiven Gesamtbild steckt allerdings eine starke Differenzierung, die man nicht vernachlässigen sollte. Betrachten wir Beispiele für nachhaltiges Wachstum deutscher Weltmarktführer unterschiedlicher Größenklassen.
Fresenius, Media Saturn, ZF Group und SAP bewegen sich heute bei etwa 20 Milliarden Euro Umsatz. Vor 20 Jahren lagen diese Unternehmen im typischen Hidden-Champions Bereich von 2-3 Milliarden Euro. Enercon, Dachser und Knorr Bremse sind von etwa 800 Millionen auf jetzt über 5 Milliarden Euro gewachsen. Auch kleinere Hidden Champions wie Beckhoff (einer der Marktführer für industrielle Automation), Rational (Weltmarktführer bei Automaten für Großküchen) und Igus (die globale Nummer 1 bei Kunststoffgleitlagern) erreichten eine Verzehnfachung der Umsätze in den letzten 20 Jahren. Diese Entwicklung ist typisch für die Hidden Champions und jenen Teile des Mittelstandes, die vom Wachstum der internationalen Märkte und Exporte profitieren.
Das Wachstum der Hidden Champions hat enorm zur positiven Entwicklung der deutschen Wirtschaft beigetragen. Die 1300 deutschen Hidden Champions haben seit 2000 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, sind mit knapp 10 Prozent pro Jahr gewachsen und heute sechsmal so groß wie 1995. Aus dieser Gruppe sind mehr als 200 neue Milliardenunternehmen entstanden, und trotz eines stark gewachsenen Weltmarktes sind die Weltmarktanteile gestiegen. In diesem Bereich finden wir also ein sehr positives Wachstumsbild vor.
Keine deutschen Super-Stars
Leider ist das nicht die ganze Wahrheit. Vergleichen wir das Wachstum deutscher Fortune Global 500 Unternehmen von 2004 bis 2014, zeigt sich ein eher negativer Trend. Im Jahre 2004 hatte Deutschland noch 37 Fortune Global 500 Firmen, heute sind es nur noch 28. Während alle Global 500 mit 6,4 Prozent pro Jahr gewachsen sind, hat die deutsche Gruppe nur ein Durchschnittswachstum von 2,8 Prozent pro Jahr erreicht. Allerdings ist die Durchschnittsbildung irreführend, denn die bessere Hälfte dieser Unternehmen schaffte 7,4 Prozent pro Jahr geschafft, also mehr als der Durchschnitt aller Global 500. Die schlechtere Hälfte packte hingegen nur 1,3 Prozent, wobei die Ausgeschiedenen in dieser Zahl nicht einmal mitgezählt sind. Abbildung 13 zeigt die 14 Unternehmen, die seit 2004 aus der Liste der Global 500 ausgeschieden sind. Vier neue (ZF, Fresenius, Talanx, Phoenix) sind hinzugekommen
Die Wachstumsdiagnose für Deutschland stellt sich wie folgt dar. Wir haben stark wachsende Unternehmen. Es gibt bei uns jedoch keine Wachstums-Superstars wie Apple oder Google. Wir haben zu viele schwach wachsende bzw. stagnierende Unternehmen. Hierfür gibt es mehrere Ursachen:
- Die Chancen der Globalisierung werden nicht genutzt
- Die Firmen halten zu lange an alten Geschäftsmodellen fest
- Es gibt in Deutschland zu wenige Start-ups mit Scaling-up Potenzial, also Start-ups, die innerhalb relativ kurzer Zeit in den Milliardenbereich vorstoßen.
Ein Beispiel für das Festhalten an alten Geschäftsmodellen liefert die Otto Group im Vergleich mit Amazon. Otto war über Jahre hinaus der größte Versandhändler der Welt. Die relative Position von Otto zu Amazon hat sich jedoch in den letzten zehn Jahren katastrophal verschlechtert.
.
These 3:
Das Wachstumsbild deutscher Unternehmen ist gespalten. Es gibt einerseits, vor allem im Mittelstand, stark wachsende Unternehmen. Es fehlen allerdings Wachstum-Superstars wie Apple. Zu viele deutsche Unternehmen stagnieren oder schrumpfen, da sie nicht globalisieren oder an alten Geschäftsmodellen kleben. Die dadurch entstehende Wachstumslücke wird anders als in Amerika nicht durch Start-ups geschlossen.
Gewinne und Börsenwerte
Mit Gewinnen und Börsenwerten sieht es in Deutschland nicht gut aus. Betrachtet man die Umsatzrenditen im internationalen Vergleich bis 2011 (leider sind nur Zahlen bis zu diesem Zeitpunkt verfügbar), liegt Deutschland liegt am unteren Tabellenende, in mehreren früheren Jahren landete Deutschland sogar auf dem zweitletzten Platz. Auch ein Vergleich der Gewinndynamik 2003 bis 2011 zeigt die im internationalen Vergleich schwache Rendite deutscher Unternehmen.
Niedrige Gewinne schlagen sich zwangsläufig in niedrigen Börsenwerten nieder. Das gilt verstärkt, wenn eine Firma nicht wächst. Als Ergebnis sind die im Dow Jones vertretenen führenden 30 US-Unternehmen mit knapp 4900 Milliarden Euro fast fünfmal so viel wert wie die im DAX gelisteten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften, die es aufetwas über 1000 Milliarden Euro bringen. Alleine Apple, Google und Microsoft sind mit 1244 Mrd. Euro mehr wert als alle DAX-Unternehmen zusammen. Mit gesundem Menschenverstand ist das schwer in Einklang zu bringen, aber das sind die realen Zahlen, die die Sicht der Kapitalmärkte wiedergeben.
Dass auch in Deutschland bzw. Europa hohe Bewertungen möglich sind, zeigen die Firmen Rational, Spotify und Geberit. Die drei Firmen erzielen Marktkapitalsierungen, die das Vielfache nicht nur des Gewinnes, sondern der Umsätze ausmachen.
Indes: größer heißt nicht notwendigerweise besser. Der Anteil der Firmen mit dem höchsten Prozentsatz, die auch die profitabelsten sind, ist im Laufe der Jahre stark zurückgegangen.
Betrachtet man das Verhältnis Wachstum versus Gewinn, rangiert Apple bei beiden Dimensionen auf höchstem Niveau. Diese Kombination zeichnet einen Superstar aus. Salesforce, Amazon und Spotify haben hohe Wachstumsraten, generieren jedoch keine Gewinne oder machen sogar Verluste. Dennoch ist die Börsenbewertung hoch. Rational und Geberit weisen umgekehrt eine sehr hohe Umsatzrendite, aber verhaltenes Wachstum auf. Auch das wird, wie schon gezeigt, von der Börse honoriert. Einige gute deutsche Firmen wie Sick, ein Hidden Champion im Sensorbereich, Linde und Bayer kombinieren Wachstum und Rendite in ausgewogener Weise. Lufthansa schneidet ähnlich wie Walmart, das größte Unternehmen der Welt, bei beiden Werttreibern schlecht ab.
These 4:
Am besten ist es, bei Wachstum und Gewinn ein Superstar zu sein (Apple). Wenn man das nicht schafft, dann sollte man entweder ein Wachstums-Superstar (Amazon, Salesforce.com) oder ein Gewinn-Superstar (Rational, Geberit) sein. Jedoch sollten 99,5% aller Unternehmen diese Empfehlungen schnellstens vergessen, da sie diese Positionen nicht erreichen können. Für typische Unternehmen empfiehlt sich eher eine vernünftige Kombination von Wachstum und Gewinn. Mit 10:10 (Umsatzrendite:Umsatzwachstum) gehört man schon zur Spitzenklasse. Das ist nichts Neues, und doch muss es immer wieder gesagt werden.
Zusammenfassung
- In der globalisierten Welt der Zukunft gibt es keine Entschuldigung für geringes Wachstum.
- Allein in den sieben wichtigsten Ländern kommen bis 2030 zwei neue USA hinzu.
- Deutschland und Europa werden nicht schrumpfen, sondern wachsen.
- Am stärken wachsen die Exporte. Die international aufgestellten deutschen Unternehmen partizipieren dank hoher Innovationskraft, Produktionsbasis und wettbewerbsfähiger Kosten voll an diesem Wachstum. Der Mittelstand spielt hierbei die zentrale Rolle.
- Es gibt in Deutschland gleichwohl zu viele Unternehmen, welche die Chancen der Globalisierung nicht nutzen oder an ihren alten Geschäftsmodellen festhalten. Auch Start-ups mit Scaling-Up-Potenzial sind Mangelware. Das sind die Ursachen unserer gesamtwirtschaftlichen Wachstumsschwäche.
- Die Achillesferse deutscher Unternehmen war und bleibt die Gewinnschwäche. Aus ihr resultieren niedrige Unternehmenswerte. Damit muss Schluss sein. Deutsche Unternehmen müssen einfach gewinnorientierter werden.
Im Fazit heißt das für deutschen Unternehmen: Nicht Wachstum versus Gewinn, sondern Wachstum UND Gewinn!
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon ist Gründer und Chairman der weltweit operierenden Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners. Twitter: @hermannsimon
















Schreibe einen Kommentar