
Exnovation und Innovation: Das Ende und der Anfang in Veränderungen
In einer Welt, die von ständigen Innovationen geprägt ist, bleibt oft wenig Raum für die gezielte Beendigung bisheriger Prozesse und den Abschied von veralteten Produkten – die Exnovation. Dabei spielt sie bei Anlässen wie Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, organisationalen Altlasten oder Digitalisierung eine entscheidende Rolle.
Von Sandra Bils und Gudrun L. Töpfer
Auch wenn es das Wort Exnovation erst in jüngerer Zeit auf die Bühne geschafft hat, lässt sich doch konstatieren, dass Exnovation schon immer Teil unternehmerischen Handelns war, ähnlich wie Innovationen es schon immer waren – und auch schon lange, bevor die darauf abzielenden Disziplinen (wie z. B. Innovationsmanagement) namentlich auf der Bühne aufgetaucht sind. Erst mit zunehmendem Umgebungsdruck ist aus der gelegentlich entstehenden Neuerung die Verpflichtung erwachsen, schneller und besser Neues hervorzubringen als andere, um daraus einen wirtschaftlichen Vorteil zu ziehen und das eigene Weiterbestehen zu sichern.
Exnovation lässt sich analog dazu anlegen: Es gab sie schon immer, mindestens in Form von aus der Produktion genommenen Produkten, der Ablösung einer veralteten technischen Anlage oder der Anschaffung neuerer (und damit dem Verwerfen alter) Werkzeuge. Erst seit kurzem wird es wichtig, Exnovation als zielgerichteten und gesteuerten Ablauf zu sehen. Betrachten wir nun nachfolgend die prominentesten Exnovationsanlässe der jüngeren Zeit und untersuchen sie im Hinblick auf Problemlage, Relevanz und mögliche Lösungsansätze.
Nachhaltigkeit
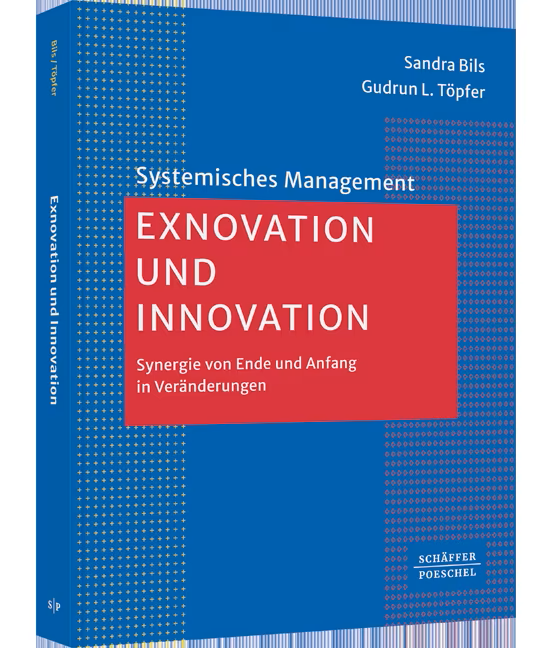
Schon seit einigen Jahren befassen sich Innovatorinnen und Innovatoren mit neuen Konzepten, wie man Nachhaltigkeit und wirtschaftliche/soziale Prosperität in Einklang bringen könnte. Forschende weisen darauf hin, dass dies möglich sei und es nicht an Innovationen und neuen Technologien/Lösungen dafür mangele, sondern vielmehr die Diffusion dieser Neuerungen in Wirtschaft und Gesellschaft nicht schnell genug ablaufe. Neben anderen Möglichkeiten (wie z. B. einer längeren Nutzungsdauer von Produkten) gilt die Exnovation als ein wichtiger Weg, um nachhaltigen Innovationen den Weg zu bereiten.
Im Kontext mit Nachhaltigkeit sind außerdem externe Exnovationsanlässe zu erwarten, die sich in Form von Vorgaben und Gesetzen auswirken. So werden Unternehmen z. B. im relativ neuen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet, die im Gesetz festgeschriebenen »menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten mit dem Ziel, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken vorzubeugen oder sie zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten zu beenden« (§ 3 Abs. 1 Satz 1 LkSG). Diese Vorgabe soll zur Exnovation schädlicher Praktiken führen und es darf davon ausgegangen werden, dass zur Förderung von Nachhaltigkeit weitere solcher Vorgaben folgen werden, wie es z. B. schon das FCKW-Verbot darstellte und wie es für Einmalverpackungen und die Verwendung von Mikroplastik aktuell im Raum steht. Das wirft natürlich die Frage nach der Verantwortung des Produktdesigns auf, denn dieses steht ganz am Anfang der Kette und die Beteiligten können schon bei der Planung auf Nachhaltigkeit Rücksicht nehmen.
Der in den letzten Jahren im Kontext mit Nachhaltigkeit diskutierte Ansatz der Kreislaufwirtschaft kann ebenfalls von Exnovation profitieren und zwar in mehrerlei Hinsicht: Zum einen kann die Beseitigung von veralteten Technologien oder Produkten dazu beitragen, nachhaltigeren Alternativen den Weg zu ebnen. Das Verbot umweltschädlicher Praktiken oder Produkte kann gleichzeitig die Entwicklung und Einführung von kreislauforientierten Lösungen stärken. Bei vielen neuen Lösungen ist eine Veränderung der Denkweise bei den Nutzenden förderlich (oder sogar erforderlich). Das Verlassen veralteter Denkweisen kann also ebenfalls durch exnovative Bemühungen unterstützt werden.
“Wer gut im Innovieren ist, muss auch gut im Exnovieren sein”
Ein konkretes Beispiel hierfür ist das Car-Sharing: Das »Ersetzen« eines Verbrennerfahrzeugs durch ein Elektro- oder Hybridfahrzeug erfordert eher wenig Umstellung oder Umdenken. Der Wechsel hin zu Car Sharing, das eine Änderung der gesamten Mobilitätslogik mit sich bringt, ist viel größer und erfordert eine veränderte Sichtweise: vom Besitz eines Fahrzeugs hin zur Inanspruchnahme einer Mobilitätsdienstleistung. Hier greift die Innovation einer System- bzw. Dienstleistungslösung mit der Produktexnovation des individuell besessenen Fahrzeugs ineinander.
Fasst man den Kreis größer, so können zu guter Letzt auch Bemühungen um eine Produktion, die Verschwendung jeglicher Art zu vermeiden sucht, zu den Exnovationsaktivitäten gezählt werden. Besonders in Zeiten des Arbeits-/Fachkräftemangels sollte sichergestellt sein, dass Personen optimal eingesetzt werden und ihre Zeit nicht mit unnützen Tätigkeiten verbringen müssen. An dieser Stelle seien stellvertretend für alle Konzepte in dieser Richtung nur das Lean Management sowie die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen genannt.
Organisationale Altlasten
Das Phänomen der Überfrachtung von Organisationen mit »Altlasten«, wie z. B. dysfunktionalen Prozessen und Routinen oder veralteten Wertevorstellungen, ist bekannt. So werden Parallelstrukturen begünstigt und die Organisation erstarrt zunehmend. Es ließe sich der Schluss ziehen: Wer gut im Innovieren ist, muss auch gut im Exnovieren sein.
“Einen verstärkenden Effekt zur Überfrachtung ergibt die Neigung des Menschen, auf der Suche nach Verbesserungen eines Zustands eher Dinge hinzuzufügen als wegzulassen”
Es ist mittlerweile ein Treppenwitz geworden, dass zwar alle eine Verbesserung wünschen, aber keiner sich wirklich verändern möchte und man lieber beim Alten bleibt.
Einen verstärkenden Effekt zur Überfrachtung ergibt die Neigung des Menschen, auf der Suche nach Verbesserungen eines Zustands eher Dinge hinzuzufügen als wegzulassen. Hinzufügen (additive change) kann als Umwandung eines Zustands verstanden werden, so dass er am Ende mehr Komponenten als zuvor aufweist, während weglassen (subtractive change) den Zustand so beschreibt, dass er am Ende weniger Komponenten als vor der Veränderung hat. In der Konsequenz tendieren Arbeitsumgebungen dazu, sich anzureichern – immer in der besten Absicht.
Ein Beispiel hierfür sind erstarrte Regelwerke, die die unselige Neigung haben, sich irgend wann zu »verselbstständigen« und dadurch nicht mehr handlungsleitend sind, sondern viel mehr lähmend werden können. Für solche Vorgänge gibt es prominente Beispiele. Ein sehr eindrückliches ist General Motors (GM). Im Jahr 2009 wurde Mary Barra zur neuen CEO ernannt und sie fand ein Unternehmen vor, das ihrer Meinung nach in bürokratischen Regeln und Vorgaben nahezu erstickte und somit unfähig wurde, sich zu bewegen und zu verändern. Eine besonders eindrückliche Manifestation dieser Kultur war ein Regelwerk, das die Bekleidungsvorschriften der Beschäftigten zum Inhalt hatte. Auf mehreren Seiten waren bis ins kleinste Detail Regeln dargelegt, und sie galten für alle Beschäftigten, von den Arbeitskräften in der Produktion bis hin zu Vertriebsmitarbeitenden.
Ein ähnliches Regelwerk existierte auch für die Firma Netflix, das – wie in vielen Firmen üblich – die Reisekostenrichtlinien darlegte und wann auf dienstlichen Reisen wie viel Geld wofür aus gegeben werden durfte. Nicht nur haben solche Regelwerke den Nachteil, dass sie notwendig unterkomplex sind, weil sie einfach nicht jeden Fall abdecken können. Will man sie kleinschrittig ausgestalten, stellt sich sogar irgendwann ein gegenteiliger Effekt ein und einzelne Regeln widersprechen sich. Nicht zuletzt: Mit einem sehr ausgefeilten Regelwerk ergibt sich zwangs läufig auch der Bedarf, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren – was wiederum Unmengen an Ressourcen verschlingt, ohne dass es produktiv auf das Firmenergebnis einzahlen würde. In beiden Fällen, sowohl bei GM als auch bei Netflix, war die radikale Exnovation des bisherigen Regelwerks die Lösung und der Ersatz sah sehr viel schmaler aus. Zur Bekleidung gab es nun noch zwei Worte zu sagen: »Dress appropriately« (angemessen kleiden). Die Reisekostenrichtlinie von Netflix heißt: »Act in Netflix’s best interest« (im besten Interesse der Firma handeln). Auch wenn dies eher Beispiele neueren Datums sind: Es gibt Beispiele dieser Denkweise schon deutlich früher, z. B. das öffentlichkeitswirksame Verbrennen des Handbuchs von Continental Airlines, das einst 800 Seiten umfasste und durch ein Manual mit etwa 80 Seiten ersetzte wurde.
Ein anderes Beispiel ist die Vielzahl von Terminen: Die Corona-Pandemie hat auf vielen Ebenen für einen »Landschaftsschock« gesorgt, also eine Erschütterung auf einer sehr übergeordneten Ebene, die vielfältige und tiefgreifende Konsequenzen zeitigte. In der Folge wurden viele altbekannte Praktiken innerhalb von Unternehmen umgestellt. So konnte man zunächst eine Umstellung von persönlicher Zusammenarbeit auf Online-Meetings feststellen, die – bald genug – in eine gewisse Müdigkeit mündete. Die damit einhergehende Belastung wurde bereits wissenschaftlich untersucht und bestätigt, ebenso wie die Schwierigkeit, der Informationsflut Herr zu werden, die als »Erleben von Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Menge an Informationen« beschrieben wird. Obwohl sich der Informationsüberfluss als »multifaktorielles Geschehen« darstellt, das vielfältige Verflechtungen mit Arbeitssituation, -organisation, dem Aufgabenzuschnitt und der allgemeinen Arbeitsplatzgestaltung hat, lohnt sich ein Blick auf das, was eventuell exnoviert werden könnte. Das Ausmisten von überflüssigen Terminen oder zumindest die Reduktion der Dauer auf ein geringeres Ausmaß kann als Akt der Exnovation angesehen werden. Einige Unternehmen gingen sogar sehr radikal vor und löschten mit einem Schlag alle Termine aus den Kalendern der Mitarbeitenden – verbunden mit der Bitte, die Meetings neu aufzusetzen und bei allen genau zu prüfen, ob und in welcher Form und Dauer diese nötig seien. Ein Beispiel dafür ist das kanadische Unternehmen Shopify, das etwa 10.000 Kalendereinträge löschte. Nach einem Monat ergab eine Rückschau, dass damit etwa 322.000 Stunden Meeting Zeit freigegeben wurden. Die aktuelle Debatte zur Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit ist eine weitere Ausprägung, die jedoch viel weiter greift, weil sie über den Arbeitskontext deutlich hinausreicht und Implikationen für die Zeitgestaltung und Arbeitsaufteilung unserer ganzen Gesellschaft hat.
Digitalisierung
Der Umbau von der analogen in die digitale Welt treibt Firmen schon viele Jahre um – und genau genommen treibt die Digitalisierung auch die Firmen vor sich her. Im Zuge der Digitalisierung stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Geschäftsprozesse, Produkte und Dienstleistungen zu transformieren. Diese Transformation erfordert nicht nur die Einführung neuer digitaler Technologien, sondern auch die kritische Überprüfung und Anpassung bestehender, oft analoger Systeme und Praktiken. Dabei mag der viel zitierte Satz gelten: Wenn Du einen schlechten Prozess hast und Du digitalisierst ihn, hast Du einen schlechten digitalen Prozess.
Hierin steckt die erste »Exnovationsherausforderung«, nämlich zunächst das Analoge gründlich »auszumisten« und um Aspekte zu bereinigen, die nicht wesentlich für das anvisierte Ziel sind. In Zuge dieser »Umwandlung« vom Analogen zum Digitalen tun sich außerdem viele Fragen auf: Heißt das, dass das Analoge nun komplett exnoviert werden muss und wir nur noch mit der digitalen Lösung weiterarbeiten? Was wird exnoviert, wie viel »Analoges« darf noch übrig bleiben? Im Sinne der Ressourcenallokation? Im Sinne des Risikomanagements?
Klar ist, dass eine Parallelstruktur, in der beides mit gleicher Kraft mitgezogen würde, zu viele Ressourcen verbrauchen würde und vor allem den analogen Prozess am Leben erhielte, der in aller Regel zeit- und energieaufwändiger ist als eine optimierte digitale Lösung.
Durch die Null-Grenzkosten-Logik digitaler Services und Inhalte darf außerdem für die Zukunft die Vermutung aufgestellt werden, dass die Löschung von nicht mehr benötigten (aber noch beibehaltenen) digitalen Inhalten einen weiteren Exnovationsanlass darstellen dürfte. Der Fokus liegt dabei weniger auf wirtschaftlichen Gesichts punkten (denn einmal erstellte digitale Inhalte kosten ja kaum etwas). Vielmehr geht es um Verwaltungsaufwand, die Aktualität der Inhalte, mögliche Sicherheitsrisiken, Inkompatibilität mit neuen Systemen oder einfach nur die Verwirrung bei den Nutzenden, die durch veraltete Inhalte ausgelöst werden könnte.
- “Kill-the-Concept”: Exnovation in einer innovationsorientierten Welt
- Die strategischen Herausforderungen deutscher Unternehmen: Drei Eckpunkte
- Verschwende keine Krise! Wann bin ich ein Sanierungsfall?
Prof. Dr. min. Sandra Bils (GFU) ist Theologin und arbeitet als Organisationsentwicklerin seit vielen Jahren im strategisch-innovativen Bereich. Sie begleitet deutschland- und europaweit Transformationsprozesse, besonders im kirchlichen Feld.
Dr. Gudrun L. Töpfer ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Unternehmensberatung Wechselwerk. Ihre Schwerpunktthemen sind Organisationsentwicklung in all ihren Facetten wie z. B. Führungskräfteentwicklung, Umgang mit großen Veränderungsprozessen, Coaching/Counseling und Teamentwicklung.























Schreibe einen Kommentar