
Wie es zur größten politischen Torheit der Bundesrepublik kommen konnte
Viele Zeitgenossen beklagen die Unsinnigkeit oder Schädlichkeit bestimmter politischer Entscheidungen auf Gebieten, von denen sie etwas verstehen, und wundern sich, dass die Politik auf sachliche Argumente einfach nicht hören will. Doch was sind die Ursachen politischer Fehlsteuerungen? Von Thilo Sarrazin.
Man denke nur an die argumentativen Breitseiten, die renommierte Ökonomen in großer Eintracht Ende 2013 und Anfang 2014 gegen die neuen gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn abgefeuert haben. Zu ihrem fassungslosen Erstaunen haben sie die Politik großenteils gar nicht erreicht, denn hier wirkten gleich mehrere Mechanismen politischer Verzerrung oder Fehlsteuerung in die entgegengesetzte Richtung. Jammern und Klagen über Mängel der Politik führt zu nichts. Ich möchte daher nicht die Zustände beklagen, sondern die Ursachen und den Charakter politischer Verzerrungen und Fehlsteuerungen näher analysieren und Vorkehrungen und Regeln beschreiben, die dem entgegenwirken.
Inhaltliche Befassung mit Haushaltsfragen wird gescheut
Das Problem liegt eben nicht auf der Ebene des Verstandes – dann könnte man der politischen Torheit leicht vorbeugen, indem man einen Mindest-IQ für Politiker vorgibt –, sondern auf der Ebene der Gefühle. Keinesfalls unterschätzen darf man das Potential der Politik zur Desinformation in komplexen Sachfragen – vor allem dann nicht, wenn diese im Bündnis mit einem großen Teil der Medien verbreitet wird. Ein Beispiel: Selbst gebildete und verständige Zeitgenossen scheuen die inhaltliche Befassung mit Währungs- und Haushaltsfragen. Meistens glauben sie das, was dazu in den Medien steht, oder überschlagen die entsprechenden Artikel gleich ganz. So haben Politik und Medien freie Bahn. Beide interessieren sich in ihrer großen Mehrheit aber gar nicht für die Währungsfrage als solche, ausschließlich für den europäischen Gedanken: Der Euro soll das Zusammenwachsen Europas fördern, und darum muss man an ihm um jeden Preis festhalten.
Man hat in den neunziger Jahren sehr wohl noch versucht, den durchaus bekannten Risiken entgegenzuwirken, aber dazu hätte die somnambule politische Klasse zumindest die Absicht erkennen lassen müssen, sich an die von ihr selbst formulierten vertraglich fixierten Vorgaben zu halten. Doch es zeigte sich wieder einmal: In zentralen Fragen ist diese politische Klasse nicht willens, die logischen Implikationen symbolischer politischer Akte vorauszuberechnen und die absehbare Entwicklung auf ihre Handlungen rückwirken zu lassen.
Ergeben sich solche Mängel quasi zwangsläufig aus dem Wesen von Politik? Und welches könnten die Heilmittel beziehungsweise Präventionsmaßnahmen sein? Gut organisierter Wettbewerb nach klaren Regeln, mehr Transparenz, mehr Dezentralität und mehr Delegation?
In Unternehmen wird man mit den Folger seiner Irrtümer schnell konfrontiert
Es ist letztlich ein komplexes Wechselspiel, in dem sich Gesellschaften und politische Systeme »ihre« Politiker erschaffen, und diese wiederum verändern die Gesellschaften und die politischen Systeme.
Manch einer wird einwenden, hier handele es sich doch um allgemeine Mängel des menschlichen Denkens und Entscheidens, die nicht auf die Politik beschränkt sind. Das ist grundsätzlich richtig, aber nirgendwo haben diese Mängel eine so große praktische Relevanz wie im politischen Raum. Im privaten Bereich oder in Wirtschaftsunternehmen wird man nämlich mit den Folgen seiner Irrtümer nicht immer unmittelbar, aber doch relativ schnell konfrontiert. Nur in der Liebe, in der Religion und in der Politik ist es möglich, über längere Zeit Wunschträumen nachzuhängen. Willenskraft und Redetalent können in politischen Spitzenämtern und erst recht in politischen Diskussionen über weite Strecken tragen. In der Wirtschaft endet solch ein Unterfangen dagegen oft schon im übernächsten Bilanzjahr. Das musste der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch im August 2014 bitter erfahren: Nachdem er die Gewinnprognosen für das laufende Jahr mehrfach hatte senken müssen, sah er sich nach nur 36 Monaten von heute auf morgen aus dem Amt als Vorstandsvorsitzender des Baukonzerns Bilfinger gedrängt und schlug dem Aufsichtsrat die einvernehmliche Trennung vor, die sofort angenommen wurde.
Nebenwirkungen inklusive
Wer Maßstäbe für die Gesellschaft und damit auch Maßstäbe für gutes Regieren entwickelt, kann niemals frei von Werturteilen sein. Das muss keine geistige Willkür bedeuten. Werturteile kann man sachlich diskutieren, und man sollte auch versuchen, sie rational zu begründen. Man muss sich aber stets der Tatsache bewusst sein, dass diese Urteile letztlich aus dem vorrationalen Raum emotionaler Antriebe kommen und damit niemals im strengen Sinn beweisbar sind. Und man muss sich zudem darüber im Klaren sein, dass unsere Handlungen oder die Handlungen des Staates neben der gewünschten Wirkung immer zahlreiche Nebenwirkungen haben. Diese müssten umfassend abgewogen werden, was aber selten möglich ist und kaum jemals ausreichend geschieht. Mit der Ethik wird es häufig umso schwieriger, je näher die konkrete Entscheidung rückt. Das zeigten etwa die Diskussionen um die Auswirkungen der jüngsten Finanzkrise, aber auch um das richtige Verhalten in der Flüchtlingskrise. Angela Merkel antwortete am 15. September 2015 auf die Kritik an ihrer Entscheidung, die deutschen Grenzen für die Flüchtlinge über die Balkanroute zu öffnen: »Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.« Die größte politische Torheit, die ein deutscher Regierungschef seit dem Zweiten Weltkrieg beging, wurde moralisch begründet, während ihre Nebenwirkungen verdrängt oder missachtet wurden.
Gutes Regieren braucht Werturteile. Soll Politik aber erfolgreich sein, reichen moralische Maßstäbe nicht aus.
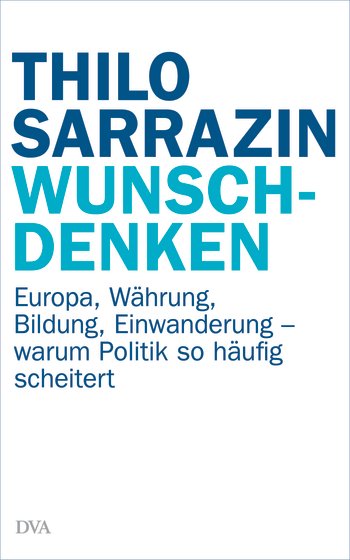 Werden wir gut regiert? Oder bleibt die Politik hinter ihren Möglichkeiten zurück? Und wenn das so ist – woran liegt das? Gibt es Techniken guten Regierens? In seinem neuen Buch “Wunschdenken. Europa, Währung, Bildung, Einwanderung – warum Politik so häufig scheitert” beschreibt Thilo Sarrazin die Mechaniken von Politik, ihre typischen Fehler und die Gründe für den Erfolg oder Misserfolg von Gesellschaften. Er verdeutlicht, warum die Vorstellungen und Träume von einer besseren Gesellschaft oft nichts Gutes hervorgebracht haben.
Werden wir gut regiert? Oder bleibt die Politik hinter ihren Möglichkeiten zurück? Und wenn das so ist – woran liegt das? Gibt es Techniken guten Regierens? In seinem neuen Buch “Wunschdenken. Europa, Währung, Bildung, Einwanderung – warum Politik so häufig scheitert” beschreibt Thilo Sarrazin die Mechaniken von Politik, ihre typischen Fehler und die Gründe für den Erfolg oder Misserfolg von Gesellschaften. Er verdeutlicht, warum die Vorstellungen und Träume von einer besseren Gesellschaft oft nichts Gutes hervorgebracht haben.
DVA, ISBN: 978-3-421-04693-2, 24,99 Euro






















Herr Zarrazin Sie haben leider immer recht, aber die von Torheit beschlagenen Politiker wollen in ihrer Besessenheit und Sturheit (DDR-Diktatur) nur ihre Interessen zum Schaden des Landes durchsetzen. Ich verachte so Personen, in erster Linie Frau Merkel für ihre dem schönen Deutschland schädigende Aktion und die negativen Auswirkungen auf die umliegenden Länder.
Dieser Frau war anscheinend nicht bewusst was sie da anstellt. Daher sollten auch Politiker zuerst Hirn einschalten und dann handeln.