
Heimarbeit & Co.: Auf die rechtssichere Umsetzung kommt es an
Was vorher undenkbar schien, wurde durch die Corona-Pandemie plötzlich möglich: Viele Beschäftigte arbeiteten vom heimischen Homeoffice aus. Unternehmen sollten aber auf die rechtssichere Umsetzung achten. Und die beginnt schon bei der richtigen Bezeichnung. Ein Überblick.
Von Sabine Hockling
Es gibt viele gute Gründe, warum Beschäftigte und Unternehmen von ortsunabhängigen Arbeitsformen begeistert sind. Es gibt aber auch ebenso gute Gründe, warum viele Bedenken haben. Arbeitsrechtlich ist die Umsetzung zwar eine Herausforderung, aber unkomplizierter möglich, als es auf den ersten Blick erscheint.
Was vorher undenkbar schien, wurde durch die Corona-Pandemie plötzlich möglich: Viele Beschäftigte arbeiteten vom heimischen Homeoffice aus, einige zog es gar ins Ausland, um dort vom Campingplatz oder von der Ferienimmobilie aus für ihre Arbeitgeber tätig zu sein. Auch nahmen viele Unternehmen die Pandemie zum Anlass, ihre Arbeitsräume zu verändern. Sie schufen Open Space Offices innerhalb des Unternehmens oder bauten ganze Büroflächen zu Co-Working-Spaces (auch für externe Personen) um.
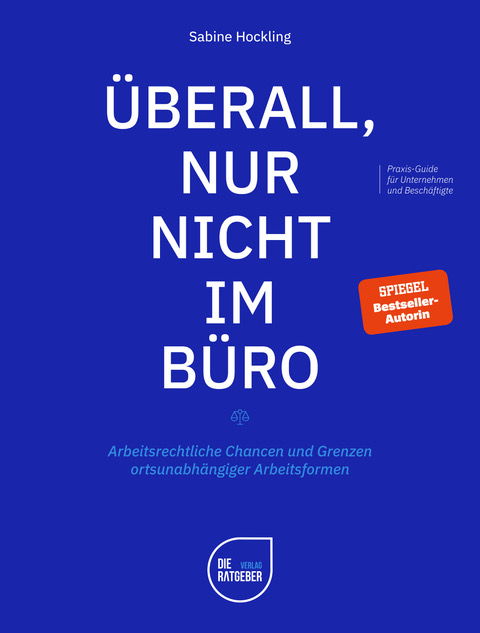
Diese zeitliche und räumliche Entgrenzung der „neuen“ Arbeitswelt ist für das Arbeitsrecht der „alten“ Arbeitswelt zwar eine Herausforderung, und Anpassungen sind daher dringend erforderlich. Unternehmen können ihren Beschäftigten diese Flexibilität aber dennoch bieten. Denn die arbeitsrechtliche Umsetzung ist unkomplizierter, als es auf den ersten Blick erscheint.
Die gesetzlichen Definitionen
Zunächst ein Blick auf die gesetzlichen Definitionen. Telearbeitsplätze werden in der Arbeitsstättenverordnung (§ 2 Abs. 7 Satz 1) geregelt. Dort lautet die Definition für Telearbeitsplätze:
„(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist.“
Für die mobile Arbeit existiert zwar noch keine bindende rechtliche Definition. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aber sprach in der inzwischen aufgehobenen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel von „mobilem Arbeiten“. Folgende Definition könnte daher Grundlage für eine zukünftige rechtliche Definition für mobile Arbeit sein:
„Mobiles Arbeiten ist eine Arbeitsform, die nicht in einer Arbeitsstätte gemäß § 2 Absatz 1 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) oder an einem fest eingerichteten Telearbeitsplatz gemäß § 2 Absatz 7 ArbStättV im Privatbereich des Beschäftigten ausgeübt wird, sondern bei dem die Beschäftigten an beliebigen anderen Orten (zum Beispiel beim Kunden, in Verkehrsmitteln, in einer Wohnung) tätig werden.“
Weiter konkretisierend heißt es dann in Abs. 3:
„Homeoffice ist eine Form des mobilen Arbeitens. Sie ermöglicht es Beschäftigten, nach vorheriger Abstimmung mit dem Arbeitgeber zeitweilig im Privatbereich, zum Beispiel unter Nutzung tragbarer IT-Systeme (zum Beispiel Notebooks) oder Datenträger, für den Arbeitgeber tätig zu sein.“
Arbeitsrechtliche Fallen vermeiden
Damit das zeitliche und ortsunabhängige Arbeiten für Arbeitgeber und Beschäftigte also nicht zur arbeitsrechtlichen Falle wird, braucht es dringend verbindliche Regularien: Wer muss für die Arbeitsplatzausstattung aufkommen? Was sieht das Arbeitszeitgesetz für die verschiedenen Arbeitsformen vor? Muss der Arbeitsvertrag bei wechselnden Arbeitsorten angepasst werden? Sollten Maßnahmen befristet werden? Sind Widerrufsklauseln sinnvoll und möglich? Können Beschäftigte auch aus nicht EU-Ländern arbeiten? Was müssen Arbeitgeber bezüglich der Sicherheit gewährleisten? Wer haftet für Schäden im heimischen Homeoffice?
Es fängt schon damit an, dass viele die Begriffe Homeoffice, Heimarbeit, Telearbeit und mobile Arbeit häufig synonym verwenden – was falsch ist und die Gefahr birgt, in eine arbeitsrechtliche Falle zu tappen. Bei Fragen rund um die Sicherheit und die Haftung. Unternehmen sind daher gut beraten, wenn sie bei der schriftlichen Vereinbarung über den Tätigkeitsort darauf achten, welche Bezeichnung sie in der Vereinbarung wählen:
- Teleheimarbeit: Tätigkeit ausschließlich von einem fest eingerichteten Arbeitsplatz zu Hause: Mitarbeitende arbeiten dauerhaft und ausschließlich aus den eigenen vier Wänden an einem vom Arbeitgeber fest eingerichteten Arbeitsplatz.
- Telearbeit: Tätigkeit temporär von zu Hause aus: Beschäftigte arbeiten gelegentlich, regelmäßig oder vorübergehend aus den eigenen vier Wänden.
- Alternierende Telearbeit: Tätigkeit aus dem Betrieb und den eigenen vier Wänden: Beschäftigte arbeiten sowohl aus den eigenen vier Wänden als auch im Unternehmen.
- Mobile Telearbeit: Tätigkeit teilweise oder ausschließlich mobil: Beschäftigte arbeiten teilweise oder permanent mobil. Dabei haben sie keinen festen Arbeitsplatz mehr im Unternehmen.
- Hybride Arbeit: Wahlrecht des Arbeitsortes: Beschäftigte können wählen, wann sie von wo aus tätig sind.
- Heimarbeit: selbstständige Tätigkeit meist aus den eigenen vier Wänden: Heimarbeiter sind nicht angestellt, sondern nach dem Heimarbeitsgesetz als Selbstständige tätig. Sie wählen ihren Arbeitsort selbst und arbeiten im Auftrag von Gewerbetreibenden erwerbsmäßig.
- Der Frust der Führungskräfte – warum die Leistungsträger die Nase gestrichen Z haben
- Die zweite Reihe
- Arbeitnehmer brauchen mehr Netto vom Brutto
Sabine Hockling Seit vielen Jahren ist die Wirtschaftsjournalistin und SPIEGEL-Bestsellerautorin mit ihrem Redaktionsbüro Die Ratgeber u.a. für die Medien ZEIT ONLINE, ZEIT Spezial, SPIEGEL ONLINE tätig. Ihre Themen reichen dabei von Arbeitsrecht, Digitalisierung bis zu Management und Transformation. Als Autorin, Herausgeberin und Ghostwriterin veröffentlicht sie regelmäßig Sachbücher.























[…] Ganzen Artikel lesen […]