
Ordnung durch Standort – Wie der Mittelstand den Rahmen stärkt
Ordnungspolitik beginnt nicht in Ministerien – sondern dort, wo Unternehmer Verantwortung für Räume übernehmen. Wer in unsicheren Zeiten langfristig investiert, setzt auf Regeln, nicht auf Zuschüsse.
Von Hans Jürgen Waschk
Was wie ein leiser Satz klingt, ist in Wahrheit ein politischer Imperativ. Denn viele ordnungspolitische Debatten unserer Zeit kreisen um die großen Systeme: Inflation, Klima, Staatsverschuldung. Dabei bleibt oft unbeachtet, dass die Ordnung unserer Wirtschaft dort beginnt, wo Unternehmer sich bekennen – zu einem Ort, zu einer Region, zu einem langfristigen Aufbau. Und genau hier liegt die Kraft eines weithin übersehenen Instruments: der Standortentscheidung des Mittelstands.
Denn Standortplanung ist keine bloße Immobilienfrage. Sie ist gelebte Ordnungspolitik – dann nämlich, wenn Eigentum, Planungssicherheit und Fachkräftebindung zusammenwirken und ohne staatliche Lenkung Werte geschaffen werden, die bleiben.
“Der Staat soll weder den Wirtschaftsprozess zu steuern versuchen, noch die Wirtschaft sich selbst überlassen: Staatliche Planung der Formen – ja; staatliche Planung und Lenkung des Wirtschaftsprozesses – nein.”— so schreibt Walter Eucken in seinem Vorwort zum ersten Band des ORDO Jahrbuchs 1948.
Diese Grundhaltung ist heute aktueller denn je. Sie fordert nicht Rückzug des Staates, sondern Klarheit über seine Rolle: Regeln setzen, nicht lenken.
Ordnungspolitische Prinzipien und ihre Dezentralität
Was ist Ordnungspolitik im Sinne Euckens oder Hayeks? Ganz einfach: Der Staat schafft die Regeln – aber er greift nicht ins Spiel ein. Er schafft Verlässlichkeit, keine Versprechen. Er setzt Rahmenbedingungen, keine Subventionen. Und er respektiert die Selbstverantwortung derer, die diese Ordnung mit Leben füllen: Unternehmer, Bürger, Kommunen.
In dieser Sichtweise wird Wirtschaft nicht gesteuert, sondern ermöglicht.
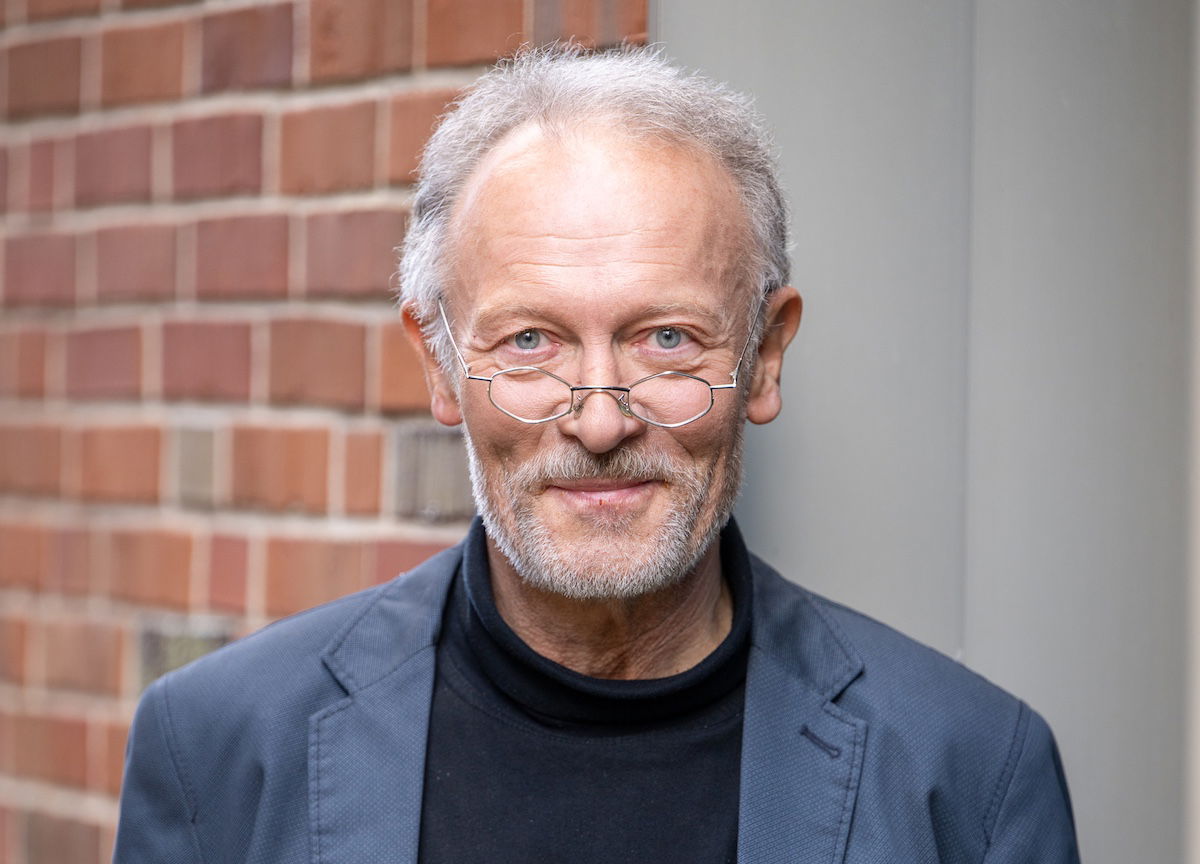
Doch gerade das braucht Mut: Ordnungspolitik setzt auf das Wissen der Vielen. Auf dezentrale Entscheidungen. Auf freie Auswahl unter fairen Bedingungen. Und nirgendwo zeigt sich dieses Prinzip so konkret wie in der Frage: Wo siedelt sich ein Unternehmen an? Welche Region bietet langfristige Perspektive? Welche Kommune wird Teil der eigenen unternehmerischen Biografie?
Standortentscheidungen sind in diesem Sinne ordnungspolitische Akte: Sie basieren auf langfristigem Denken, setzen Eigentum voraus, erfordern Vertrauen in funktionierende Infrastruktur, stabile Steuern und soziale Anschlussfähigkeit. Kein Unternehmer verlagert ein Werk aus romantischer Heimatliebe – sondern weil die Ordnung stimmt.
Die Standortfrage als wirtschaftspolitische Grundsatzfrage
Wenn man heute über Fachkräftemangel, Deindustrialisierung oder regionale Disparitäten spricht, dann redet man oft über Symptome. Die Ursachen liegen tiefer: im fehlenden Vertrauen vieler Unternehmen in einen stabilen, vergleichbaren Ordnungsrahmen quer durch Deutschland.
Denn wer heute eine Produktionsstätte plant, braucht Übersicht, Transparenz, steuerliche Planbarkeit und ein verlässliches Umfeld. Doch dieser Rahmen fehlt vielerorts. Die Informationslage ist fragmentiert. Wer als Unternehmer den Mut zur Verlagerung hat, wird oft durch Bürokratie, Unübersichtlichkeit oder mangelnde Unterstützung gebremst.
Dabei wäre die Lösung einfach – und ganz im Geist der Ordnungspolitik:
Ein deutschlandweites, digitales Standortkataster, das klar zeigt:
- Welche Flächen sind verfügbar?
- Wo besteht Planungsrecht, wo nicht?
- Wie sind die Infrastrukturen angebunden?
Ein solches Kataster – vergleichbar mit BORIS-NRW oder Baulückenregistern – würde nicht zentralistisch lenken, sondern Transparenz schaffen. Es würde Wettbewerb zwischen Regionen ermöglichen – nicht um Subventionen, sondern um Klarheit, Qualität und Anschlussfähigkeit. Und es würde den Mittelstand befähigen, jene Entscheidungen zu treffen, die heute zu oft verzögert oder ganz unterbleiben: Die mutige Wahl eines zukunftsfähigen, aber heute noch unterschätzten Standorts.
Drei Modellfälle – Künzelsau, Melsungen, Blomberg
Dass solche Standortentscheidungen ordnungspolitisch wirken können, zeigt ein Blick in die jüngere Wirtschaftsgeschichte. Drei Orte, drei Unternehmen, drei Beweise:
- Würth in Künzelsau
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Hohenlohe eine wirtschaftlich schwache Region. Adolf Würth gründete dort sein Unternehmen – nicht auf staatliche Lenkung hin, sondern aus eigener Initiative. Der Standort entwickelte sich zum Zentrum eines Weltmarktführers. Arbeitsplätze entstanden, Familien blieben, die Region wuchs. Ordnungspolitisch betrachtet ist Künzelsau ein Musterbeispiel für gelungene Dezentralisierung durch unternehmerische Entscheidungskraft. - B. Braun in Melsungen
Der Medizintechnikkonzern entschied sich früh für eine Konzentration im nordhessischen Melsungen – abseits der Metropolen. Mitten im ländlichen Raum entstand ein Hochtechnologiestandort mit globaler Ausstrahlung. Auch hier: kein Ruf nach Subventionen, sondern die bewusste Wahl eines Standorts, der Eigenständigkeit, Eigentum und langfristige Entwicklung möglich machte. - Phoenix Contact in Blomberg (Bild oben)
Schon im Zweiten Weltkrieg verlagerte das Unternehmen aus dem Ruhrgebiet nach Ostwestfalen. In Blomberg entstanden über Jahrzehnte hochinnovative Fertigungsstätten. Der Ort wurde stabilisiert, die Region gestärkt. Auch dieser Fall zeigt: Die Kombination aus Investition, Vertrauen und Ordnung kann Regionen prägen – ohne Intervention, aber mit langfristiger Wirksamkeit.
Reformvorschlag: Der Ordnungsrahmen für Standorttransparenz
Was folgt daraus für die Wirtschaftspolitik heute? Vor allem eines:
Der Staat muss keine Förderprogramme auflegen. Er muss keinen neuen Zentralfonds gründen. Aber er muss Transparenz ermöglichen.
Ein bundesweites Standortkataster, gegliedert nach klaren Kategorien (bestehende Flächen, planungsrechtlich vorbereitete Flächen, potenzielle Erweiterungsflächen), wäre ein echtes ordnungspolitisches Instrument. Es würde keine Standorte verordnen – aber die Wahl erleichtern. Es würde keinen Investor drängen – aber allen ermöglichen, schneller, klarer und faktenbasiert zu entscheiden.
So entsteht Wettbewerb – nicht um Fördergelder, sondern um Zukunft.
Ergänzend könnte man steuerliche Anreize schaffen, um Produktionsstätten aus dem Ausland zurückzuholen – ebenfalls ein ordnungspolitischer Hebel: nicht durch Lenkung, sondern durch Gleichheit der Rahmenbedingungen.
Vor allem aber sollte Politik aufhören, die Standortfrage als Nebenkriegsschauplatz zu behandeln. Denn sie ist Kernfrage jeder wirtschaftlichen Ordnung. Und sie entscheidet mit darüber, ob Deutschland in der Fläche investiv, lebendig und sozial stabil bleibt – oder ob sich Wachstum immer weiter in die Ballungsräume verengt.
Schluss: Ordnung durch Entscheidung
Wo Eigentum, Planungssicherheit und Eigenverantwortung zusammentreffen, entsteht Ordnung – nicht durch Dekrete, sondern durch Haltung. Standortentscheidungen des Mittelstands sind ordnungspolitische Akte im besten Sinne: leise, langfristig, wirksam.
Was sie brauchen, ist kein Beifall – sondern ein Rahmen, der Klarheit schafft. Dann wird Ordnungspolitik nicht nur gedacht, sondern gelebt.
- Das Standortranking Deutschland auf DDW
- Boris Palmer: Lasst die Kommunen doch bitte machen
- Weitere Standortanalysen auf DDW
Hans Jürgen Waschk ist Bauassessor, Dipl.-Ing. Architekt & Standort-Planer sowie Autor. Er hat mehr als 33 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Planung und Umsetzung von Bauprojekten für KMU und Familienunternehmen. Kontakt auf LinkedIn
























Ein hervorragend formulierter Beitrag, der den Blick für die oft unterschätzte Bedeutung der ordnungspolitischen Standortentscheidung schärft. Besonders überzeugend ist die Betonung, dass nachhaltige Wirtschaftskraft dort entsteht, wo Unternehmer langfristig Verantwortung übernehmen – unabhängig von kurzfristigen Subventionen. Der Vorschlag eines bundesweiten digitalen Standortkatasters ist ein klarer, pragmatischer Impuls, der echte Transparenz schafft und unternehmerische Entscheidungen erleichtert. Ein starkes Plädoyer für mehr Vertrauen, Planungssicherheit und Dezentralisierung – genau das, was unsere Wirtschaft jetzt braucht.
Ein starker Beitrag mit ungewohnter Tiefenschärfe.
Dieser Artikel macht deutlich, was in vielen wirtschaftspolitischen Diskussionen zu kurz kommt: Dass Standortentscheidungen keine bloßen Investitionsentscheidungen sind, sondern ordnungspolitische Akte. Sie beruhen auf langfristigem Denken, auf Vertrauen in verlässliche Rahmenbedingungen – und sie wirken weit über betriebswirtschaftliche Aspekte hinaus.
Besonders bemerkenswert ist die Verbindung von Gegenwartsanalyse mit einem strukturellen Verständnis für zukünftige Entwicklungen – infrastrukturell wie unter makroregionaler Perspektive. Wer so denkt, erkennt: Standortplanung ist mehr als Baugrund und Quadratmeterpreise. Sie ist Ausdruck von Haltung, Verantwortung und dem Mut zur Dezentralität.
Ein inspirierender Appell für eine Ordnungspolitik, die auf Transparenz, Klarheit und Eigenverantwortung setzt – und damit Raum für Zukunft schafft.
Antwort auf den Kommentar von Frank G.
Herzlichen Dank für Ihre differenzierte Resonanz, Herr G.
Es freut mich besonders, dass Sie den ordnungspolitischen Kern der Argumentation aufgegriffen haben: Unternehmer-Verantwortung statt Subvention, Transparenz statt Steuerung.
Die Standortfrage ist – wie Sie so treffend formulieren – eine oft unterschätzte Stellschraube für wirtschaftliche Stabilität und regionale Resilienz.
Der Mittelstand denkt und handelt langfristig – vorausgesetzt, der Rahmen stimmt.
Genau hier kann ein digitaler Ordnungsrahmen – wie das vorgeschlagene Standortkataster – eine enorme Hebelwirkung entfalten.
Danke für Ihre wertvolle Perspektive. Sie bestärkt mich darin, den Dialog über Standortfragen und Ordnung weiterzuführen.
Mit besten Grüßen
Hans Jürgen Waschk
Antwort auf den Kommentar von Diana Becker
Ganz herzlichen Dank, Frau Becker – Ihre Rückmeldung trifft den Kern.
Besonders freut mich, dass Sie die Standortentscheidung als das erkennen, was sie im besten Sinne sein kann: ein ordnungspolitischer Akt mit langfristiger Wirkung. Denn wer sich zu einem Ort bekennt, gestaltet nicht nur Wirtschaft – sondern auch Gesellschaft, Raum und Zukunft.
„Raum für Zukunft“ ist eine schöne Formulierung, die ich gern aufgreife. Sie bringt auf den Punkt, worum es geht: Klarheit schaffen, Eigenverantwortung ermöglichen – und dadurch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Zukunft überhaupt planbar und gestaltbar wird.
Danke sehr für Ihren Beitrag zu diesem Dialog.
Mit besten Grüßen
Hans Jürgen Waschk
„STANDORT-PLANUNG ist ZUKUNFTS-PLANUNG“ – ein Satz, der weit über geografische Fragen hinausweist.
Als wirtschaftspsychologische Impulsgeberin und KI-Begleiterin für Familienunternehmen sehe ich täglich, wie entscheidend es ist, innere und äußere Orientierung zu verbinden.
Der Beitrag bringt das auf den Punkt: Standort ist nicht nur eine Frage des Ortes, sondern eine Frage der Haltung, der Struktur und der Zukunftsstrategie. Danke für diesen kraftvollen Impuls!
Ich danke für die deutlichen Worte in diesem Beitrag.
Es bleibt zu hoffen, dass dieser Weckruf bei den politischen Entscheidungsträgern auf Resonanz stößt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
Darüber hinaus möchte ich an dieser Stelle auch auf die Bedeutung des Föderalismus in unserer Bundesrepublik hinweisen. Die häufig uneinheitlichen Regelungen zu ein und demselben Thema dürfen insbesondere bei Standortentscheidungen nicht außer Acht gelassen werden.
Gerade im globalen Kontext, in dem wir heute leben, wirken derartige Unterschiede oftmals wenig zeitgemäß.
Hans Jürgen Waschk sagt:
Antwort auf den Kommentar von Christa Raatz
Vielen Dank, Frau Raatz, für Ihre nachdenkliche Rückmeldung.
Dass Sie den Satz „Standort-Planung ist Zukunfts-Planung“ so aufnehmen, freut mich sehr. Genau das ist mein Anliegen: Standort ist nicht nur Geografie, sondern Verantwortung – nach innen wie nach außen. Für Menschen. Für Strukturen. Für Richtung.
Ihr Hinweis auf die Verbindung von innerer und äußerer Orientierung passt ausgezeichnet. Gerade im Mittelstand wird oft intuitiv richtig entschieden – aber selten öffentlich darüber gesprochen. Umso wichtiger, dass wir das Thema sichtbarer machen.
Mit besten Grüßen
Hans Jürgen Waschk
Antwort auf den Kommentar von Karl Kotté
Vielen Dank, Herr Kotté, für Ihre klaren Worte.
Ja – dieser Weckruf richtet sich ausdrücklich auch an die Politik. Wenn Standortentscheidungen Vertrauen brauchen, dann braucht Vertrauen Verlässlichkeit – gerade in einem föderalen System. Unterschiedliche Regelwerke und fragmentierte Prozesse sind ein Standortfaktor, über den wir endlich offen sprechen sollten.
Ihr Hinweis auf den globalen Kontext ist zentral. Wer heute international Verantwortung trägt, kennt den Unterschied zwischen ordnender Vielfalt und lähmender Kleinteiligkeit.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Jürgen Waschk
Ein klarer Blick aus der Sicht der Praxis.
Danke für die neuen Idee zur Vereinfachung von Wachstum.
Ein Blick aus der Erfahrung heraus sinnvoll zu Gestalten.
Mehr Sinn erschafft Ressourcen und schont natürliche Ressourcen, fördert Kreativität und Innovation. Die Werte einer deutschen Wirtschaft.
Rahmen gibt innere Räume frei für Wachstum mit guter Intention.
Es schafft Raum für echten nachhaltigen Wachstum in der Region, der nicht gesteuert und kontrolliert wird um Normen der Begrenzungen zu erfüllen.
sehr interessanter Ansatz…
toller Bericht, vor Allem für den Mittelstand
Antwort auf den Kommentar von Christiane Trautwein-Lykke
Vielen Dank, Frau Trautwein-Lykke, für Ihre eindrücklichen Worte.
Ihr Hinweis auf die Verbindung von innerem und äußerem Raum trifft einen Punkt, der im ökonomischen Diskurs oft zu kurz kommt.
Standort-Entscheidungen wirken nicht nur technisch, sondern auch kulturell – sie setzen Kräfte frei oder blockieren sie.
Wo unternehmerisches Wachstum nicht kontrolliert, sondern sinnvoll gerahmt wird, entsteht etwas Tragfähiges: für Menschen, für Regionen, für das Ganze.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Jürgen Waschk
Resonanz auf den Kommentar von Melanie
Vielen Dank, Melanie – gerade Ihre Rückmeldung aus dem Herzen des Mittelstands bedeutet mir viel.
Wenn wir über Standort sprechen, meinen wir oft nur Gebäude oder Boden. Dabei geht es auch um Strukturen, Abläufe, Entscheidungen – genau das, was den Arbeitsalltag prägt.
Freut mich sehr, wenn der Beitrag dort Impulse geben konnte.
Mit besten Grüßen
Hans Jürgen Waschk
Ein eindringlicher Beitrag – und ein Appell, der nicht ungehört verhallen darf. Denn Deutschlands Unternehmertum – vom Familienbetrieb bis zum Weltmarktführer – braucht endlich das, was längst selbstverständlich sein sollte: einen klaren, verlässlichen Rahmen für Standortentscheidungen. Ohne Transparenz, Übersicht und Planbarkeit verlieren wir Zeit, Vertrauen und Wettbewerbsfähigkeit. Ein bundesweites Standortkataster ist keine bürokratische Kür, sondern überfällige Pflicht. Ordnungspolitik darf kein Theoriegebäude bleiben – sie muss gelebt werden. Dafür braucht es jetzt politischen Mut, Klarheit zu schaffen, bevor andere längst Fakten schaffen.
Antwort auf den Kommentar von Stefan Düsel
Lieber Herr Düsel,
haben Sie vielen Dank für Ihre klare Resonanz. Sie sprechen einen zentralen Punkt an: Transparenz und Verlässlichkeit sind kein Luxus, sondern Grundbedingung für unternehmerisches Handeln. Genau hier sehe ich die ordnungspolitische Verantwortung – Rahmen zu schaffen, die Entscheidungen erleichtern, statt sie zu behindern.
Der Gedanke eines Standortkatasters zielt genau darauf ab: Übersicht geben, Orientierung ermöglichen und Vertrauen zurückgewinnen. Dass Sie dies so deutlich unterstreichen, zeigt, dass die Diskussion dringend geführt werden muss – nicht abstrakt, sondern mit Blick auf die Praxis der Unternehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Jürgen Waschk