
Bildung muss differenzieren, nicht gleichschalten
Bildung geht nicht ohne Anstrengung. Wir müssen unseren jungen Leuten wieder mehr zutrauen und mehr zumuten. Deshalb brauchen wir im Bildungsbereich eine Renaissance des Leistungsprinzips. Von Peter Schmidt
Bildung ist keine Maßnahme zur Herstellung von Gleichheit, sondern zur Förderung von Verschiedenheit und Individualität. Die „conditio humana“ kennt keine Gleichheit. Gleiches muss gleich, Unterschiedliches unterschiedlich behandelt werden. Verschiedenheit ist keine Ungerechtigkeit. Vielmehr ist nichts so ungerecht wie die gleiche Behandlung Ungleicher. Differenzierung im Bildungswesen ist zudem eine notwendige Voraussetzung für individuelle Förderung von Kindern. Die anti-thetische Formel „Fördern statt Auslese“ ist grundfalsch. Es muss heißen: Fördern durch Differenzierung. Egalitäre Bildungspolitik indes erzielt vermeintliche Gleichheit allenfalls durch Absenkung des Anspruchsniveaus.
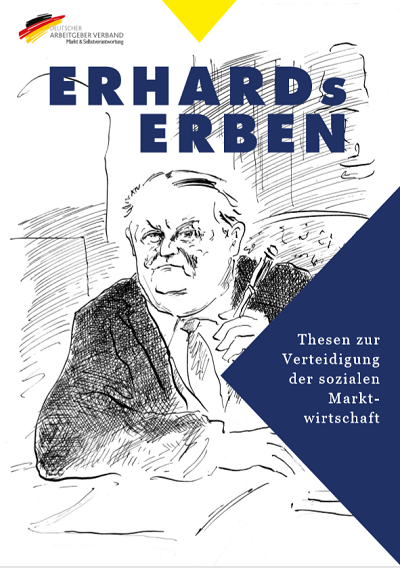 Der Beitrag “Deutschland verdummt“ von Dr. Michael Winterhoff vom 17.7.19 hat auf DDW und in den Sozialen Medien eine rege Diskussion um das Thema Bildung in Deutschland angeregt. Ausgehend von der Kritik am Prinzip einer “bindungsfreien” Pädagogik stellte der Autor die katastrophalen Folgen der Kita-, Kindergarten- und Schulpolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte dar, die zur Zeit die Ausbilder in den Unternehmen und Hochulprofessoren erleben.
Der Beitrag “Deutschland verdummt“ von Dr. Michael Winterhoff vom 17.7.19 hat auf DDW und in den Sozialen Medien eine rege Diskussion um das Thema Bildung in Deutschland angeregt. Ausgehend von der Kritik am Prinzip einer “bindungsfreien” Pädagogik stellte der Autor die katastrophalen Folgen der Kita-, Kindergarten- und Schulpolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte dar, die zur Zeit die Ausbilder in den Unternehmen und Hochulprofessoren erleben.
Der heutige Beitrag unserer Themenreihe “Bildung” auf DDW stammt aus dem Thesenpapier “Erhards Erben – Thesen zur Verteidigung der freien Marktwirtschaft” des Deutschen Arbeitgeberverbandes e. V. . Ziel des Thesenpapiers soll es sein, Leitplanken zu den gesellschaftlich drängendsten Fragen an die Hand zu geben – einen Minimalkonsens sozusagen. Die Beiträge sollen Anstoß zu weiterer inhaltlicher Diskussion jenseits parteipolitischer Präferenzen sein, weshalb sich der Verband auf Meinungen und Rückmeldungen aus der Unternehmerschaft freut: schmidt@arbeitgeberverband.de
Wir brauchen eine gebildete Leistungs- und Funktionselite
Bildung geht nicht ohne Anstrengung. Eine Wohlfühl-, Gute-Laune-, Spaß- und Gefälligkeitspädagogik schadet unseren Kindern. Wir müssen unseren jungen Leuten wieder mehr zutrauen und mehr zumuten. Deshalb brauchen wir im Bildungsbereich eine Renaissance des Leistungsprinzips. Leistung ist die große Chance zur Emanzipation für jeden einzelnen. Ganz zu schweigen davon, dass der Sozialstaat nur dann funktioniert, wenn er von der Leistung von Millionen von Menschen getragen wird. Wir brauchen eine gebildete Leistungs- und Funktionselite, die zugleich Verantwortungs-, Reflexions- und Werte-Elite ist. Vor einem solchen Hintergrund ist selbst Ungleichheit gerecht – nämlich dann, wenn Elite allen nützt, wenn das Handeln von Eliten quasi zu einem „inequality surplus“, zu einem Mehrwert führt.
“Wir sollten uns vor lauter Schielen auf die Abiturientenquote hüten, die Vorzüge unseres beruflichen Bildungswesens zu verspielen”
Zu einem Bildungswesen gehören ehrliche Noten und Zeugnisse. Zur Farce werden Noten und Zeugnisse, wenn sie nur noch „sehr gut“ oder schlimmstenfalls „gut“ ausfallen, das heißt, wenn Spitzennoten beim Abitur, bei den Hochschulprüfungen einschließlich von Promotionen inflationär vergeben werden. Der Mensch beginnt nicht erst mit dem Abitur. Wir sollten uns vor lauter Schielen auf die Abiturientenquote hüten, die Vorzüge unseres beruflichen Bildungswesens zu verspielen. Unser berufliches Bildungswesen ist für Millionen junger Menschen Basis für Aufstieg und Beschäftigung.
Viele Länder – nicht nur der zweiten und dritten Welt – wären froh, über Vergleichbares zu verfügen. Dass die Quote arbeitsloser junger Menschen weltweit nirgends so niedrig ist wie in Deutschland, hat mit den Strukturen beruflicher Bildung hier zu tun. Mit einer Pseudo-Akademisierung verspielen wir diese Vorzüge.
Wir brauchen Bildung statt Pisa-Testeritis
Es gibt keine Bildung ohne Inhalte. Wir brauchen einen Primat der Inhalte vor vagen Kompetenzkatalogen, mit denen Lehrpläne zu Leerplänen zu werden drohen. Die blanke Forderung nach einer bloßen Vermittlung von Kompetenzen wäre wie der Vorschlag, ohne Wolle stricken zu lernen. Es ist eine Renaissance des konkreten Wissens angesagt. Dies ist auch deshalb wichtig, weil kanonisches Vorratswissen Verlässlichkeit bietet und weil es eine wichtige Kommunikationsgrundlage ist.
Wer aber nichts weiß, muss alles glauben. Er ist damit kein mündiger Staatsbürger, denn er ist dann verführbar für jeden Demagogen, für jede politische Emotionalisierung. Bei ihm würde Gesinnung über Urteilskraft triumphieren. Wir brauchen Bildung statt Pisa-Testeritis. Denn Pisa misst nur einen kleinen Sektor aus dem Lerngeschehen. Ausgeblendet bleiben bei Pisa weite Bereiche von Bildung: Fremdsprachen, Literatur, Religion/Ethik, Geschichte, Kunst, Musik, Sport. Wir brauchen eine Schule jenseits von Pisa. Wir müssen uns wieder auf den Eigenwert des Nicht-Messbaren besinnen. Wir sind mit dem Grundsatz, dass unsere Schulen Allgemeinbildung und nicht nur Messbares leisten sollen, gut gefahren.
“Das Volk der großen Dichter, Denker und Pädagogen droht bildungspolitisch in die Falle eines bloßen Nützlichkeitsdenkens zu tappen”
Bildung hat einen zweifachen Auftrag: Sie hat durchaus Nützliches und Verwendbares zu vermitteln, sie hat aber auch persönliche und kulturelle Identität zu fördern. Das Gleichgewicht zwischen Bilanzierung und Freiraum, zwischen Verwertungsdenken und Bildungsauftrag, zwischen Ökonomie und Kultur ist allerdings weg. Das Volk der großen Dichter, Denker und Pädagogen droht bildungspolitisch in die Falle eines bloßen Nützlichkeitsdenkens zu tappen. Mit solchen Denkansätzen aber droht eine planwirtschaftliche Verarmung von „Bildung“.
Junge Leute brauchen eine wirtschaftsbürgerliche Grundbildung. Aus dem jungen Menschen soll ein mündiger Wirtschaftsbürger werden. Mindestens 200 Stunden ökonomische Grundbildung sollte jeder Schulabsolvent durchlaufen haben. Er sollte wissen, was die Architekturprinzipien und die Leitideen der Sozialen Marktwirtschaft sind. Junge Leute müssen einen konstruktiv-kritischen Umgang mit neuen Medien vermittelt bekommen. Eine totale Computerisierung schulischen Lernens bringt allerdings nicht den erwarteten Erfolg. Der Computer kann nicht zum Selbstzweck werden. Erziehung zur Medienmündigkeit ist angesagt. Hier geht es zunächst um die Fähigkeiten, sinnentnehmend zu lesen, verständlich zu schreiben, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden sowie Informationen zu sortieren und zu bewerten.
Bildungsföderalismus garantiert Wettbewerb um die leistungsfähigsten Bildungssysteme
Es gibt keine Bildungsoffensive ohne Erziehungsoffensive. Wenn es zu Hause nicht klappt, dann klappt es in der Schule nicht. Das heißt: Es ist die Eigenverantwortung der Familien wieder stärker gefordert. Eigentlich ist dies eine Selbstverständlichkeit, die als Pflicht sogar im Grundgesetz (GG) und im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgehalten ist. Grundgesetz Artikel 6, Absatz 2 lautet nämlich: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ Leider wird der zweite Teil dieses Satz gerne vergessen. Ein Bildungsföderalismus garantiert Wettbewerb um die leistungsfähigsten Bildungssysteme. Ein Bildungszentralismus aber vereinheitlicht Ansprüche auf niedrigem Niveau. Mit einem kompetitiven Bildungsföderalismus als konstruktivem Stachel ist wenigstens ein Minimum an Wettbewerb garantiert.
 Peter Schmidt ist Ehrenpräsident des Deutscher Arbeitgeber Verband e.V.
Peter Schmidt ist Ehrenpräsident des Deutscher Arbeitgeber Verband e.V.
Weitere Beiträge in unserer Themenreihe:























Schreibe einen Kommentar