
So werden Milliarden für Entwicklungshilfe verschwendet
Millionenbeträge für fragwürdige, teils skurrile Projekte in aller Welt, wenn in Deutschland oft für das Nötigste nicht genug Geld vorhanden ist: Die deutsche Entwicklungshilfe ist in der Diskussion. Die wichtigere Frage aber ist: Erreichen diese Ausgaben überhaupt das, was sie erreichen sollen?
von Dr. Dr. Rainer Zitelmann
Soeben ist das neue Buch von Rainer Zitelmann erschienen: „Warum Entwicklungshilfe nichts bringt und wie Länder wirklich Armut besiegen.“ DDW bringt nachfolgend einen Auszug aus dem Vorwort.
Lange Zeit war die Entwicklungshilfe kein Thema in der öffentlichen Diskussion in Deutschland. Obwohl jährlich zweistellige Milliardenbeträge für Entwicklungshilfe (heute: „Entwicklungszusammenarbeit“ genannt) ausgegeben werden, wurde nur selten gefragt, wofür dieses Geld ausgegeben wird und ob die proklamierten Ziele erreicht werden. Die Politiker und die zuständigen staatlichen Stellen konnten das Geld ausgeben, wie sie wollten, weil die Medien und die Opposition nur selten kritische Fragen stellten.
Das hat sich 2022/2023 geändert. Politiker von CDU/CSU, FDP und AfD begannen, zumindest einzelne Positionen zu hinterfragen. FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer warf der Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) vor, eine „überdehnte Entwicklungshilfe“ zu betreiben. „Alles, was nicht für Deutschlands Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen nützlich ist, hat hinten anzustehen“, so der Politiker. Deutschland fördere zum Beispiel Projekte wie „Kapazitätsaufbau und Gender-Training für zivilgesellschaftliche Basis-Organisationen und Sozialarbeiterstationen in einer Provinz Chinas“ und ein „Netzwerk für gendertransformative Bildung“ in Afrika. Zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Kamerun durch „gendertransformative Ansätze“ seien beispielsweise 21 Millionen Euro bis 2028 verplant. „Bei den Ausgaben müssen wir daher genauer hinschauen und diese auf Effizienz trimmen“, sagte der liberale Politiker.
Geld für „konsumkritische Stadtspaziergänge“
Während sich früher Medien kaum dafür interessierten, nahm jetzt sogar BILD das Thema auf. Kritisiert wurde etwa, dass mit Steuergeldern die „Förderung der entwicklungspolitischen Bildung“ finanziert werde. Rund 43 Millionen Euro wurden 2024 dafür ausgegeben. Dabei würden unter anderem sogenannte „konsumkritische Stadtspaziergänge“ von Vereinen gefördert. Anhänger der „Eine-Welt-Gruppe“ werben für diese Schulungsmaßnahmen: „Bei den Stadtrundgängen geht es um Globalisierung, nachhaltigen Konsum, Postwachstum und Kapitalismuskritik.“
Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler kritisierte auf Social Media:
„Konsumkritische Stadtspaziergänge sind geführte Rundgänge durch städtische Gebiete, bei denen die Teilnehmer auf die Auswirkungen und Problematiken des Konsumverhaltens aufmerksam gemacht werden. Dabei wird kritisch hinterfragt, wie Konsum das Stadtbild, die Umwelt und die soziale Struktur beeinflusst. Ziel ist es, das Bewusstsein der Teilnehmer für nachhaltigere und verantwortungsbewusstere Konsumpraktiken zu schärfen. Diese Spaziergänge werden von verschiedenen Organisationen angeboten und durchgeführt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat dafür zwischen den Jahren 2019 und 2023 den Organisationen 37.775 Euro Steuergeld zur Verfügung gestellt. Für 2024 stehen wieder 8.000 Euro zur Verfügung.“
Ein Sprecher von Entwicklungshilfeministerin Schulze rechtfertigte diese Ausgaben: „Konsumkritische Spaziergänge ermöglichen eine Auseinandersetzung mit dem Thema Fairer Handel in unserem Alltag.“ Stadtführer nähmen dabei „Produkte unseres Alltags wie Smartphones, Kaffee oder Elektroartikel genauer unter die Lupe“. Solche Projektförderungen umfassten laut Ministerium in den letzten fünf Jahren insgesamt 4 051 783 Euro. 6.500 meist junge Leute nahmen an den Schulungen organisiert von 18 Eine-Welt-Vereinen teil.
Die Radwege in Peru
Freilich sind das kleine Beträge, wenn man sie in Relation setzt zu anderen Ausgaben. Für besondere Aufregung sorgte die Diskussion um die Förderung für Radwege in Peru. Im Jahr 2020 waren zunächst 20 Millionen Euro für den Ausbau des Radwegenetzes in Lima vorgesehen. Zwei Jahre später, 2022, folgten weitere 24 Millionen Euro für Radwege in anderen Städten Perus. Die Mittel werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verwaltet, die gemeinsam mit der Stadtverwaltung von Lima das Projekt plant und umsetzt.
Ziel sei es, ein Radwegenetz von insgesamt 114 Kilometern Länge zu schaffen, schreibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die sich im Rahmen einer Reportage vor Ort in Lima ein Bild von den Radwegen machte. Bisher seien allerdings erst 5,5 Kilometer des ehrgeizigen Projekts realisiert worden, heißt es in dem Bericht.
Vor Ort bot sich der FAZ-Autorin folgendes Bild: „Der doppelspurige neue Radweg verläuft auf dem Mittelstreifen zwischen zwei schnurgeraden Schnellstraßen. Breit genug, dass auch zwei Fahrräder aneinander vorbeikommen, eingegrenzt von gelb gestrichenem Kantstein. Ein wunderbarer Fahrradweg – und wir haben ihn für uns allein.” Doch genutzt werde der Fahrradweg kaum, so die Autorin: „Um vier Uhr nachmittags ist kaum ein Radfahrer zu sehen. Dafür ist der Lärm und Gestank der Busse, Autos und Tuk-Tuks umso größer, die rechts und links an uns – in gebührendem Abstand – vorbeirauschen“, schreibt sie.
Jener Radweg in Villa El Salvador, im äußersten Süden Limas, werde längst auch von Fußgängern, Familien mit Kindern oder Hundebesitzern als Spazierweg genutzt. Radfahrer seien in der Minderheit. Viele, die sich vor Ort aufs Rad schwingen, „biken damit am Wochenende in den Bergen. Die brauchen den Radweg eigentlich nicht“, sagt ein Mann, der eine Fahrradwerkstatt betreibt.
Grüne Kühlschränke für Kolumbien und positive Makulinität in Ruanda
Doch das ist nicht das einzige Projekt, das kritisch gesehen wird. Das von Robert Habeck (Grüne) geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz etwa förderte „grüne Kühlschränke“ in Kolumbien mit 4,6 Millionen Euro. Geld fließt auch für erneuerbare Energien in Chile (1,7 Millionen Euro), für emissionsarme Reiserzeugung in Thailand (8,1 Millionen Euro) oder für die energetische Sanierung von Wohngebäuden in der Mongolei (6,2 Millionen Euro).
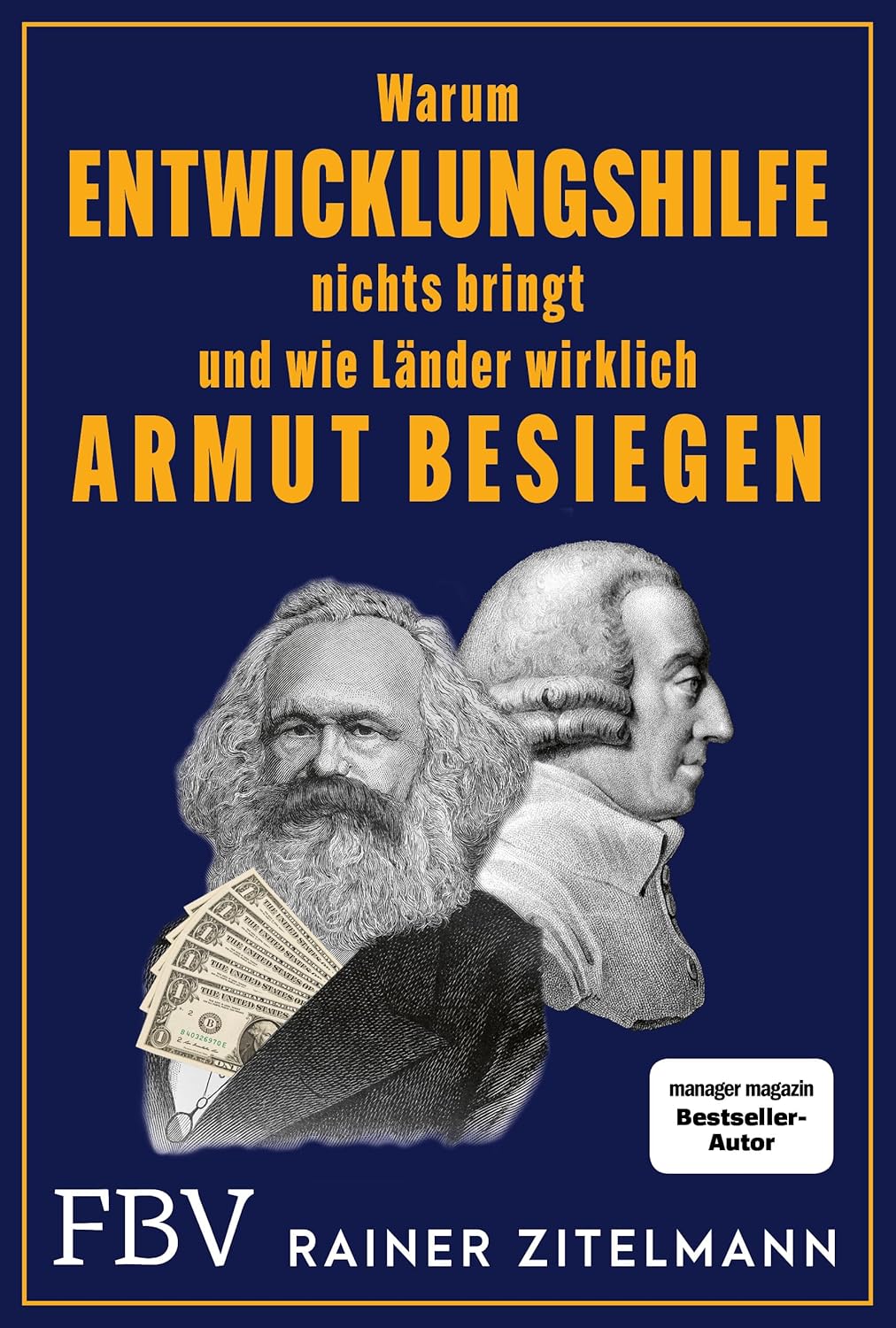
Deutsche Steuergelder fließen auch in den Aufbau einer modernen Steuerverwaltung in Kamerun (fünf Millionen Euro), in den kommunalen Umweltschutz in Kolumbien (80,5 Millionen Euro) und für den Ausbau von klimafreundlichen ÖPNV-Systemen in Lateinamerika (106,5 Millionen Euro).
Auch die Biodiversität in Paraguay (sechs Millionen Euro) und die Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung in Timbuktu (24,5 Millionen Euro) liegen dem Ministerium sehr am Herzen. Ebenso wie Gender-Trainings in China und ein Projekt zu positiver Maskulinität in Ruanda, wohin ebenfalls deutsche Steuergelder fließen.
8,5 Millionen Euro will das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für „Grüne Moscheen und Gebäude in Marokko“ ausgeben. Moscheen werden mit LED-Beleuchtung und Solarpanels bestückt. Über 100 Moscheen wurden bereits energetisch modernisiert und in der Stadt Tadmant sogar der Bau einer „Plusenergiemoschee“ gefördert. Das Vorhaben, so erklärt das Ministerium, diene auch noch einem anderen Zweck: „Zweitens sensibilisiert das Vorhaben die marokkanische Bevölkerung über die Fortbildung von Multiplikator/innen sowie Imanen und Mourchidas, weiblichen Religionsgelehrten, über Medienkampagnen.“
Der Tenor der Diskussion ist: Warum werden solche Projekte gefördert, wenn in Deutschland oft für das Nötigste – etwa die Instandhaltung von Schulen und die Bundeswehr – nicht genug Geld vorhanden ist? Diese Fragen sind berechtigt, sie wirken aber für den einen oder anderen auch ein wenig egoistisch. Bringt es nicht mehr, etwas für den Klimaschutz in Peru zu tun als das Geld in Deutschland auszugeben, lautet die Gegenfrage.
“Die Grundfrage lautet: Was hilft aus ökonomischer Sicht wirklich gegen Armut?”
Was weniger gefragt wird: Erreichen diese Ausgaben überhaupt das, was sie erreichen sollen? Kommt das Geld wirklich an? Ist den armen Ländern damit wirklich geholfen? Diese Fragen stelle ich im zweiten Kapitel dieses Buches.
Doch zunächst werde ich mit der Grundfrage beginnen: Was hilft aus ökonomischer Sicht wirklich gegen Armut? Diese Frage war die Leitfrage des schottischen Ökonomen Adam Smith, und seine Antwort erläutere ich im ersten Kapitel.
Ich habe mehrere Bücher über Reichtum geschrieben – warum schreibe ich jetzt ein Buch über Armut und deren Überwindung? Weil ich in meinen Forschungen zu dem vermeintlich paradoxen Ergebnis gekommen bin, dass nur eine Gesellschaft, die Reichtum zulässt und Reichtum positiv sieht, Armut überwinden kann.
Beeindruckende Fallbeispiele, wie Armut überwunden werden kann
Repräsentative Meinungsumfragen, die ich in zahlreichen Ländern habe durchführen lassen, zeigen, dass die Menschen besonders in zwei Ländern Reichtum und Reiche im Vergleich positiver sehen: Polen und Vietnam. Zugleich sind dies auch Länder, in denen die Menschen – trotz der unterschiedlichen politischen Systeme – den Begriff „Kapitalismus“ sehr viel positiver beurteilen als ihre Zeitgenossen in den meisten anderen Ländern.
Und es sind zwei Länder, die in den vergangenen Jahrzehnten außerordentlich stark an wirtschaftlicher Freiheit gewonnen haben. Die amerikanische Heritage-Foundation erstellt seit 1995 ein Ranking der wirtschaftlichen Freiheit – man kann es auch Kapitalismus-Skala nennen –, und in keinem Land vergleichbarer Größe nahm die wirtschaftliche Freiheit in diesem Zeitraum so sehr zu wie in Polen und Vietnam.
Diese beiden Länder sind besonders beeindruckende Fallbeispiele dafür, wie Armut überwunden werden kann. Deshalb wird ihre Geschichte in diesem Buch ausführlich geschildert.
Beide Länder waren der Schauplatz schrecklicher Kriege, in denen Abermillionen Menschen ihr Leben ließen – der Zweite Weltkrieg in Polen und der Indochinakrieg in Vietnam. Nach den Kriegen wurden in beiden Ländern sozialistische Planwirtschaften errichtet, die das zerstörten, was der Krieg noch nicht zerstört hatte. Vietnam war eines der ärmsten Länder der Welt und Polen eines der ärmsten Länder Europas. Ich schildere in diesem Buch das Leben in diesen Ländern in den Zeiten der Planwirtschaft, und Sie werden sehen, wie bitterarm die Mehrheit der Menschen dort war.
Die Vietnamesen begannen 1986 mit marktwirtschaftlichen Reformen, die man Doi-Moi-Reformen nennt. Wenige Jahre später entschloss sich auch Polen zu marktwirtschaftlichen Reformen. In beiden Ländern führten diese Reformen zu einem bemerkenswerten Wirtschaftswachstum und einer dramatischen Verbesserung des Lebensstandards. Ich werde dies mit Zahlen und Statistiken zeigen sowie anhand von Lebensberichten der Menschen in diesen Ländern.
- Rainer Zitelmann für renommierten Literatur-Preis nominiert
- Reihe „Weltreise eines Kapitalisten“ von Rainer Zitelmann auf DDW
- Wohlstand und Armut von Nationen
Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist Historiker und Soziologe – und war auch als Unternehmer und Investor erfolgreich. Er hat 29 Bücher geschrieben und herausgegeben, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden (zuletzt “Weltreise eines Kapitalisten“, “Warum Entwicklungshilfe nichts bringt und wie Länder Armut wirklich besiegen“, “Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten“). In den vergangenen Jahren schrieb er Artikel oder gab Interviews in führenden Medien wie Wall Street Journal, Times, Le Monde oder Corriere della Sera. Seit kurzem kann auch eine Master-Class “Finanzielle Freiheit – Schluss mit der Durchschnittsexistenz” belegt werden.























Es ist unfassbar wie so genannte “Politiker” unser Steuergeld hirnlos, instinktlos und verantwortungslos, zum Fenster rausschmeißen. Hier im Land verkommt alles und die finanzieren Radwege in Peru und Gebäudesanierung in der Mongolei !
Da muss ich ehrlich gesagt den eigenen Blinker nach rechts setzen. In 4 Tagen ist Wahl und uns bleibt die Hoffnung dass dieses verantwortungslose Pack dann keine Posten mehr bekommt.
Hier ertrinkt man schon im Frust.
Danke schön Günther, du sprichst mir aus der Seele. Wir haben uns anfangs in unserer Familie auch den Kopf über diese Entgleisungen der Politik geärgert. Wir sind uns aber schon lange einig, dass nur blau wählen wirklich hilft. Der Merz holt sich die Grünen ins Haus und kriegt nichts auf’m Kabel, weil diese Kommunisten volles Pfund auf der Bremse stehen werden.