
Space to Grow – ein neues Buch zur Space Economy
Fesselnde Geschichten von Changemakern und den zukünftigen Möglichkeiten der Ökonomie des Weltraums – das bieten Matthew Weinzierl und Brendan Rosseau in ihrem Buch.
Von Dr. Dr. Zitelmann
Der 14. November 2011 bezeichnete einen Tiefpunkt der bemannten Raumfahrt für die USA: Der amerikanische Astronaut Daniel Burbank musste mit einer russischen Sojus-Rakete zur Raumstation ISS gebracht werden, weil die Amerikaner nach der Einstellung des Shuttle Programms keine eigene Rakete mehr hatten, mit der sie dies hätten tun können.
Es folgten in den nächsten Jahren 30 weitere Flüge von US-Amerikanern mit russischen Sojus-Raketen – bis dann am 30. Mai 2020 erstmals eine Falcon 9 Rakete von Space X wieder Amerikaner zur ISS brachte.
Strukturell bedingtes Versagen
Das Versagen der staatlichen bemannten Raumfahrt nach der erfolgreichen Apollo-Mondlandung ist nach Meinung von Matthew Weinzierl und Brendan Rosseau (beide von der Harvard Business School) strukturell bedingt und liege an der zentralen Planung:
„Das Fehlen von Wettbewerb, wie man ihn in einem freien Markt sieht, bedeutet, dass es nur begrenzte Anreize für Effizienz und Innovation gibt. Mit der Zeit verschlechtern sich Preissignale, sodass es nahezu unmöglich wird, selbst für wohlmeinende zentrale Planer, die beste Art der Ressourcenverteilung zu bestimmen. Und allzu oft, wenn wir die Kontrolle in die Hände einiger weniger öffentlicher Entscheidungsträger legen, entsteht Druck, konzentrierten Interessen zu dienen, statt den Interessen der Gesellschaft. Diese strukturellen Schwächen untergruben im Laufe der Zeit das amerikanische Raumfahrtprogramm. Ironischerweise sind es genau dieselben Schwächen, die die Wirtschaft der Sowjetunion – des damaligen Rivalen im Weltraumrennen – zu Fall brachten.“ (S. 17)
S. Pete Worden, Deputy of Technology in der Strategic Defense Initiative Organization beim Department of Defense kritisierte 1992 in einem Vortrag:
„Da die NASA de facto für den verschwenderischsten Teil des Kongresses arbeitet, ist es nicht überraschend, dass ihre Programme darauf ausgelegt sind, Arbeitsplätze in wichtigen Kongressdistrikten zu schaffen und zu erhalten. Das Space Shuttle-Space Station-Programm ist ein ungeheuerliches Beispiel. Fast zwei Drittel des NASA-Budgets sind in diesem sich selbst erhaltenden Programm gebunden. Das Shuttle ist ein unglaublich teurer Weg, um ins All zu gelangen – 1 Milliarde Dollar pro Start … Da zehntausende Arbeitsplätze an diesen Programmen hängen und auch der Großteil des NASA-Budgets, gibt es nicht nur kein Geld, um aus dieser endlosen Schleife auszubrechen, sondern sogar politischen Druck, sicherzustellen, dass wir nicht ausbrechen. Man beachte, dass nicht einmal 175 Millionen Dollar aus dem 14-Milliarden-Budget der NASA gefunden werden konnten, um ein neues, kostengünstigeres Startsystem zu entwickeln.“ (S. 25 f.)
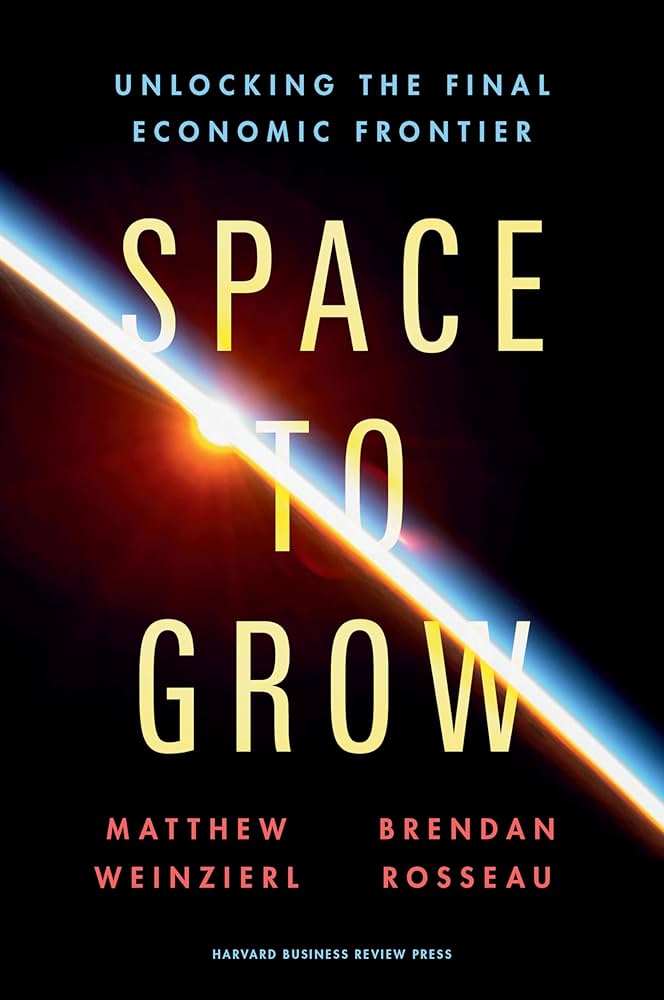
Luft- und Raumfahrtunternehmen haben ihre Raketen typischerweise aus Bauteilen gebaut, die aus einem weit verzweigten und komplexen Netz von Zulieferern stammen. Die Autoren zitieren den NASA-Forscher Harry Jones, der schätzte, dass die ULA (United Launch Alliance, ein 2006 gegründetes Joint Venture von Boeing Defense, Space and Security und Lockheed Martin Space Systems) „hunderte von Subunternehmern hatte, die über Dutzende von Standorten im ganzen Land verteilt waren“.
Space X konnte viel billiger produzieren
Wie Jones betont, war dies „eine politische Notwendigkeit für ein staatlich finanziertes Arbeitsbeschaffungsprogramm“. (S. 73) Letztlich wurde das System immer ineffizienter, weil politische Maßgaben – jeder Bundesstaat wollte seinen Anteil am Programm haben – und nicht sachliche Argumente viele Entscheidungen bestimmten. Dagegen konnte und kann Space X viel billiger produzieren, da es solche Rücksichten nicht nehmen muss und viele Komponenten inhouse herstellt. Space X schätzt, dass „jeder Dollar, der aus dem Unternehmen herausging, tatsächlich zwischen 3 und 5 Dollar kostete, basierend auf Gemeinkosten und Gewinnaufschlägen der Subunternehmer“. (S. 73)
Man muss der NASA zugute halten, dass sie selbst die Art der Zusammenarbeit mit privaten Raumfahrtunternehmen wie Space X änderte – und so dazu beitrug, dass sich die private Raumfahrt durchsetzen konnte. Erwähnt werden muss hier vor allem das NASA-Förderprogramm Commercial Orbital Transportation Services (COTS), um den Transport von Ausrüstungen, Versorgungsgütern und Experimenten zur und von der ISS mit Hilfe von privatwirtschaftlichen Unternehmen zu ermöglichen. Das Programm wurde am 18. Januar 2006 angekündigt und war ein voller Erfolg.
“Nach Jahrzehnten der Stagnation in der bemannten Raumfahrt haben erst private Firmen wirklich Innovationen gebracht”
Der Abschied von unsinnigen „cost-plus“-Programmen und privater Wettbewerb führte, so die Autoren, dazu, dass die launch costs bei Space X im Vergleich zum Space Shuttle um über 90 Prozent reduziert wurden (S. 55), an anderer Stelle wird sogar von einer Kostenreduktion um 95 Prozent gesprochen (S. 35). Doch dies, so die Überzeugung der Autoren, sei erst der Anfang. Das Starship von Space X werde es in Zukunft ermöglichen, die launch costs auf einige Millionen Dollar zu reduzieren. „Mit einer Kapazität von 150.000 Kilogramm bedeutet das, dass die tatsächlichen Kosten für den Transport einer Nutzlast in den niedrigen Erdorbit (wo die meisten Satelliten betrieben werden) bei etwa 200 Dollar pro Kilogramm liegen könnten – eine Größenordnung niedriger selbst als bei der Falcon 9. Das würde bedeuten, dass Space X die Startkosten im Vergleich zum Shuttle in nur wenigen Jahrzehnten um 99 Prozent gesenkt hätte.“ (S. 78 f.)
Aufschlussreich ist auch ein Vergleich des Starship mit dem NASA-System SLS. Das Space Launch System, kurz SLS, ist eine im Auftrag der NASA entwickelte Schwerlastrakete; der erste unbemannte Start fand am 16. November 2022 statt, ein erster bemannter Start ist für 2026 geplant. „Jeder Start der Rakete und ihrer Raumkapsel Orion soll 4,2 Milliarden Dollar kosten. Bis zum ersten Start des SLS hatte die NASA fast 24 Milliarden Dollar für seine Entwicklung ausgegeben – darunter 6 Milliarden an Kostensteigerungen und über 6 Jahre Verzögerung über die ursprünglichen Planungen der NASA hinaus.“
Wettbewerb ist es, der zu Innovation und Kostensenkung führt
Space X schätzt, dass die Kosten für einen launch des Starships bei 10 Millionen Dollar liegen werden. Aber selbst wenn diese Schätzung viel zu optimistisch ist und die Kosten zehn Mal höher sein sollten, wären sie immer noch 42 mal geringer als beim SLS (S. 149).
Die Autoren sind keine Gegner der NASA oder generell der staatlichen Raumfahrt. Vielmehr betonen sie:
„Regierungen werden immer eine wesentliche Rolle bei der Koordination, Subventionierung und Beratung privater Unternehmen spielen, die die Grenze der Raumfahrtwirtschaft vorantreiben.“ (S. 52)
An anderer Stelle schreiben sie:
„So wie das Besteuern oder Regulieren von Aktivitäten, die Weltraumschrott erzeugen, eine negative Externalität internalisieren kann, kann das Subventionieren oder Unterstützen von Aktivitäten mit positiven externen Effekten einen Wert schaffen, der in einem reinen Markt nicht realisiert würde.“ (S. 193)
Auch ich glaube, dass man auf staatliche Raumfahrt – zumindest heute noch nicht – vollständig verzichten kann, aber ich bin skeptischer als die Autoren, was die Förderung durch Subventionen anlangt. Nach Jahrzehnten der Stagnation in der bemannten Raumfahrt haben erst private Firmen wirklich Innovationen gebracht, und es spricht nichts dafür, dass staatliche Behörden oder Politiker am besten beurteilen könnten, welche Zukunftstechnologien und Unternehmen gute Aussichten haben und welche nicht. Was funktioniert, und dies betonen auch die Autoren an vielen Stellen, ist Wettbewerb, der zu Innovation und Kostensenkung führt.
Besprechungen von weiteren 15 Büchern zur Space Economy finden Sie hier:
Exploring The Space Economy — Institute of Economic Affairs
- New Space Thema beim „InnoNation“ Festival in Berlin
- Französisch-Deutsches Space Meeting in Berlin
- „Space – The Free Market Frontier“: Ein visionäres Buch aus dem Jahr der Space X-Gründung
Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist Autor des Buches „Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten“, das in 30 Sprachen übersetzt wurde. Er schreibt für Medien wie Wall Street Journal, National Interest, City AM, Neue Zürcher Zeitung und L’Express. Bücher und Seminare finden Sie hier
























Schreibe einen Kommentar