
Deutschlands strategisches Defizit in einer Welt im Umbruch
Eine Welt im Umbruch verlangt von Deutschland Gelassenheit und Mut, Selbstbewusstsein und Entschlossenheit zur Gestaltung. Wir müssen Bestandsaufnahme machen, Ziele formulieren und Strategien entwickeln, die sich an unseren Interessen orientieren. Es gibt ein Gremium, das sich zu einem starken, koordinierenden Instrument solcher Strategien ausbauen ließe.
Von Rüdiger von Fritsch
Global, strategisch zu denken hat in Deutschland keine Tradition – vielen klingt das noch immer zu sehr nach Macht und Großmacht. In den mehr als siebzig Jahren unseres staatlichen Bestehens gab es nie eine »nationale Sicherheitsstrategie«, die alle Fragen zugleich in den Blick genommen hätte. An einer solchen wird nun erstmals gearbeitet – länger als geplant. Jeder will beteiligt werden, und der Dissens beginnt schon in der Regierung. Im Land der Kompromisse und der Konsensdemokratie besteht die Gefahr, dass sie gleich wieder überladen wird: ein Weihnachtsbaum, an den jedes Ressort und jede Interessengruppe ihr Lametta hängt.
“Es bedarf einer klaren Vorgabe und einer einheitlichen Strategie bei der Umsetzung der internationalen Politik, die für jedes Ressort in seiner Zuständigkeit bindend ist”
Dem Mangel an strategischer Ausrichtung entspricht eine strukturelle Schwäche unseres Handelns – seine »Versäulung«: Es wird nicht zusammengefügt, was die einzelnen Ressorts der Bundesregierung im internationalen Bereich an Zielen und Politiken verfolgen. Jedes größere Ministerium hat seinen eigenen Planungsstab, für ein koordiniertes Vorgehen fehlt es an institutioneller Voraussetzung. Das Auswärtige Amt, das Umweltministerium, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Verteidigungsministerium oder das Wirtschaftsministerium – jedes Ressort arbeitet für sich. Zum medialen Dauerbrenner der außenpolitischen Debatte in Deutschland gehört die Frage, ob Bundeskanzler und Außenministerin oder Bundeskanzlerin und Außenminister wohl auf einer Linie liegen. Es stellte den Ausnahmefall dar und bedurfte offensichtlich erst der Krise, dass der Bundeskanzler im Knäuel sich widerstreitender Partei- und Ressortinteressen ein Machtwort sprach und darüber entschied, ob und wie die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert werden soll.
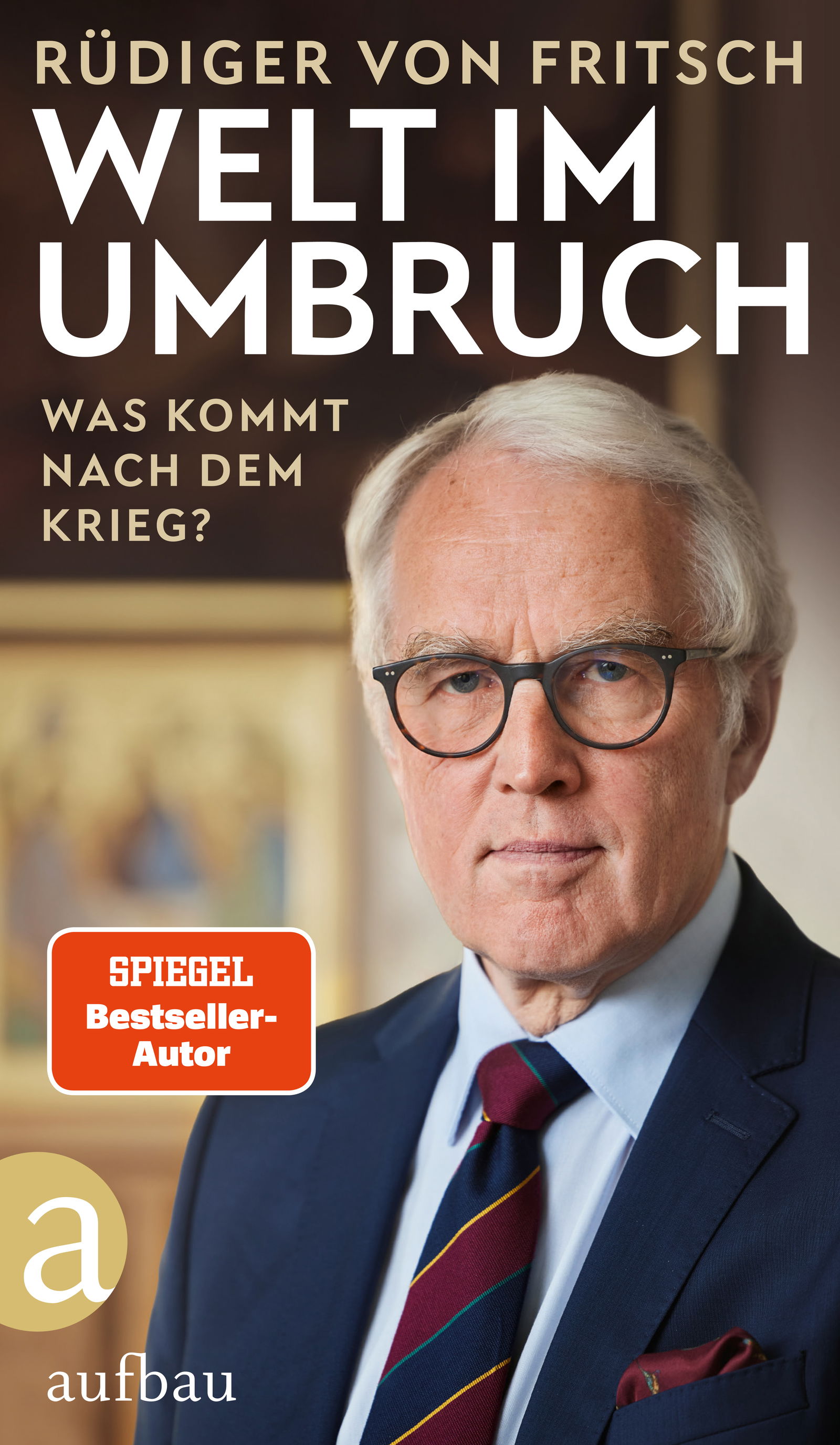
Versäulung zu beenden bedeutet nicht, dem Bundeskanzler, dessen Position ohnehin stark ist, weitere Kompetenzen oder Machtbefugnisse zuzuweisen. Doch es bedarf einer klaren Vorgabe und einer einheitlichen Strategie bei der Umsetzung der internationalen Politik, die für jedes Ressort in seiner Zuständigkeit bindend ist. Eine einheitliche Strategie sollte im Übrigen nicht nur Leitlinie für die Arbeit von Ministerien sein.
Strategien und Handlungsvorschläge erarbeiten
Kaum ein Land verfügt über so viele – und so gute – Instrumente außenpolitischen Handelns wie Deutschland: den Deutschen Akademischen Austauschdienst und die Auslandshandelskammern, das Goethe-Institut und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, die politischen Stiftungen, die den Parteien nahestehen und andere mehr. Sie alle arbeiten mit Steuergeldern. Es würde ihre Unabhängigkeit nicht einschränken, wenn sie mehr an einem Strang zögen und nicht, wie so oft, in ihrem besonderen Interessenfeld vor sich hin puzzelten. Das gilt auch für das Agieren der Bundesländer im Ausland. In Brüssel kann man uns leicht ausspielen, weil es neben der Vertretung der Bundesrepublik noch 15 teils große Länderbüros gibt, die Partikularinteressen verfolgen.
“Unser Land hat Besseres verdient”
Es gibt ein Gremium der Bundesregierung, das sich zu einem starken, koordinierenden Instrument ausbauen ließe: den Bundessicherheitsrat, der sich bisher vornehmlich mit Fragen von Rüstungsexporten beschäftigt. In diesem Gremium könnten die grundlegenden Herausforderungen der internationalen Politik analysiert, unsere Abhängigkeiten und strategischen Verwundbarkeiten definiert werden. Darauf aufbauend könnte der Bundessicherheitsrat für das Parlament und die Regierung Strategien und Handlungsvorschläge erarbeiten, die mit denen unserer beiden wichtigsten Bündnisse, der Europäischen Union und der NATO, abgestimmt, gemeinsam beschlossen und dann kohärent umgesetzt werden sollten. Wo die Bundesländer zuständig sind, sollten im Bundesrat auf der Grundlage nationaler Strategien Leitlinien für ein gleichgerichtetes Handeln der Länder verabredet werden, sodass deren teils sich widerstreitende Interessen zum Ausgleich gebracht werden und Alleingängen ein Riegel vorgeschoben ist.
Die gegenwärtige Bundesregierung hatte sich vorgenommen, einen starken nationalen Sicherheitsrat zu schaffen – das Projekt scheiterte: am Kompetenzgerangel. Außenministerin und Bundeskanzler konnten sich nicht darüber einigen, wo er angesiedelt sein sollte. In Zeiten multipler, miteinander verflochtener Herausforderungen wird eine Frage nationaler strategischer Handlungsfähigkeit Opfer des Streites um Zuständigkeiten. Unser Land hat Besseres verdient.
Rüdiger von Fritsch, geboren 1953, bereitete die EU-Osterweiterung als Unterhändler in Brüssel vor, er war Leiter des Planungsstabes des Bundespräsidenten und Vizepräsident des BND. Von 2010 bis 2014 war er Botschafter in Warschau und von 2014 bis 2019 Botschafter in Moskau. Heute ist er Partner des geostrategischen Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors. Seine Bücher »Russlands Weg«, »Zeitenwende« und jetzt auch sein neues Buch »Welt im Umbruch« – aus dem dieser Text stammt – wurden zu SPIEGEL-Bestsellern.























Schreibe einen Kommentar