
Weltreise eines Kapitalisten: Washington, New York und Boston, USA
Viele Menschen träumen von einer Weltreise. Ich habe eine Weltreise in 30 Länder gemacht: Meine »Liberty Journey«, immer der Freiheit auf der Spur. Mein nächstes Ziel: USA / Reihe Weltreise eines Kapitalisten
- Folge 1: Zürich, Schweiz
- Folge 2: Tiflis, Georgien
- Folge 3: Seoul und Gangwon, Korea
- Folge 4: Santiago de Chile
- Folge 5: Washington, New York und Boston, USA
Von Dr. Dr. Rainer Zitelmann
Im März und April habe ich mehrfach in der Woche, mitunter gar mehrfach täglich Interviews mit amerikanischen Radiostationen. Vermittelt hatten mir diese Interviewtermine die PR-Agentur Publius von A. J. Rice. Die Kooperation ist für mich etwas Neues, denn ich habe davor mit vier verschiedenen PR-Agenturen in den USA zusammengearbeitet, die alle Folgendes verband: viel versprochen, viel gekostet und nichts geliefert. Da ich selbst Inhaber einer der führenden PR-Agenturen in Deutschland war, kann ich beurteilen, was eine gute und was eine schlechte PR-Agentur ist. Leider sind 95 Prozent der Agenturen schlecht, vermutlich überall auf der Welt.
Wegen der Zeitverschiebung finden diese Interviews – wenn ich sie aus Deutschland führe – oft sehr spät statt, manchmal erst nach Mitternacht. Als ich A. J. Rice mal sage, Termine um 3 Uhr früh in Deutschland wolle ich nur ausnahmsweise wahrnehmen, antwortete er kurz: »The fight for Western civilization doesn’t end at midnight.« Das hat mir gefallen.
In den großen Zeitungen in den USA dominieren eher linke Meinungen, bei den Radiostationen anders
Überwiegend, aber nicht nur, spreche ich mit konservativen bzw. rechten Talkshows. US-Talkshows kenne ich bis dahin nur aus dem Fernsehen, sogar einer meiner Lieblingsfilme, den ich Dutzende Male gesehen habe, handelt von einem solchen amerikanischen Hörfunkformat: »Talk Radio« von Oliver Stone. Konservative Talkshows spielen seit der Reagan-Zeit eine große Rolle in den USA. Davor gab es die »Fairness Doctrine« der Federal Communications Commission, die Radiosender zu einer politischen Ausgewogenheit verpflichtete. Diese wurde aber 1987 abgeschafft.
Während in den großen Zeitungen in den USA eher linke Meinungen dominieren, ist das bei den Radiostationen anders. Linken Radiosendern gelang es nicht im gleichen Maße, Zuspruch beim Publikum zu finden, wie rechten. In den etwa 50 Interviews, die ich führte, merkte ich zweierlei: Erstens waren meine Gesprächspartner überwiegend »prokapitalistisch«. Zweitens hinderte sie das nicht, teilweise populistischen Anti-Big-Business-Thesen zu folgen. Manche Interviewer behaupten, die Milliardäre seien heute in den USA auch links. Ich versuche ihnen klarzumachen, dass das nur eine kleine Minderheit ist – Leute wie George Soros, die zwar in den Medien viel Gehör finden, deren Meinungen jedoch keineswegs repräsentativ sind für erfolgreiche Unternehmer oder Investoren in den USA.
Manche hängen offensichtlich den – auch unter Konservativen und einigen Libertären – populären Verschwörungstheorien an, wonach es ein großes Komplott zur Etablierung einer »New World Order« unter Leitung von Klaus Schwab gebe, dem Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF). Ich selbst halte nichts von Verschwörungstheorien, da diese die Rolle von Planung und Absicht für den Verlauf politischer und geschichtlicher Entwicklungen maßlos überschätzen. Um politische Entwicklungen zu verstehen, brauche ich keine Verschwörungserklärungen. Mir genügen die Macht der Ideologie, die Macht der Dummheit und die Macht des Konformismus als Erklärung.
Der Affekt gegen Reiche und Superreiche ist in den USA nicht auf die politische Linke beschränkt, sondern reicht weit in das rechte Lager. Zweifellos trifft das auch für manche der Talkshows zu, wie ich den Fragen der Interviewer entnehme. Aber keineswegs auf alle. Viele sind einfach erfrischend prokapitalistisch – so, wie wir Europäer uns manchmal Amerikaner vorstellen. Es gibt diese Amerikaner noch, die an Kapitalismus und Unternehmertum glauben und dem Staat (»Big Government«) skeptisch gegenüberstehen.
Libertäre Freunde
Nachdem ich im März schon einmal in den USA (und zwei Mal in Polen) war, mache ich mich Anfang April wieder auf den Weg in die Vereinigten Staaten.
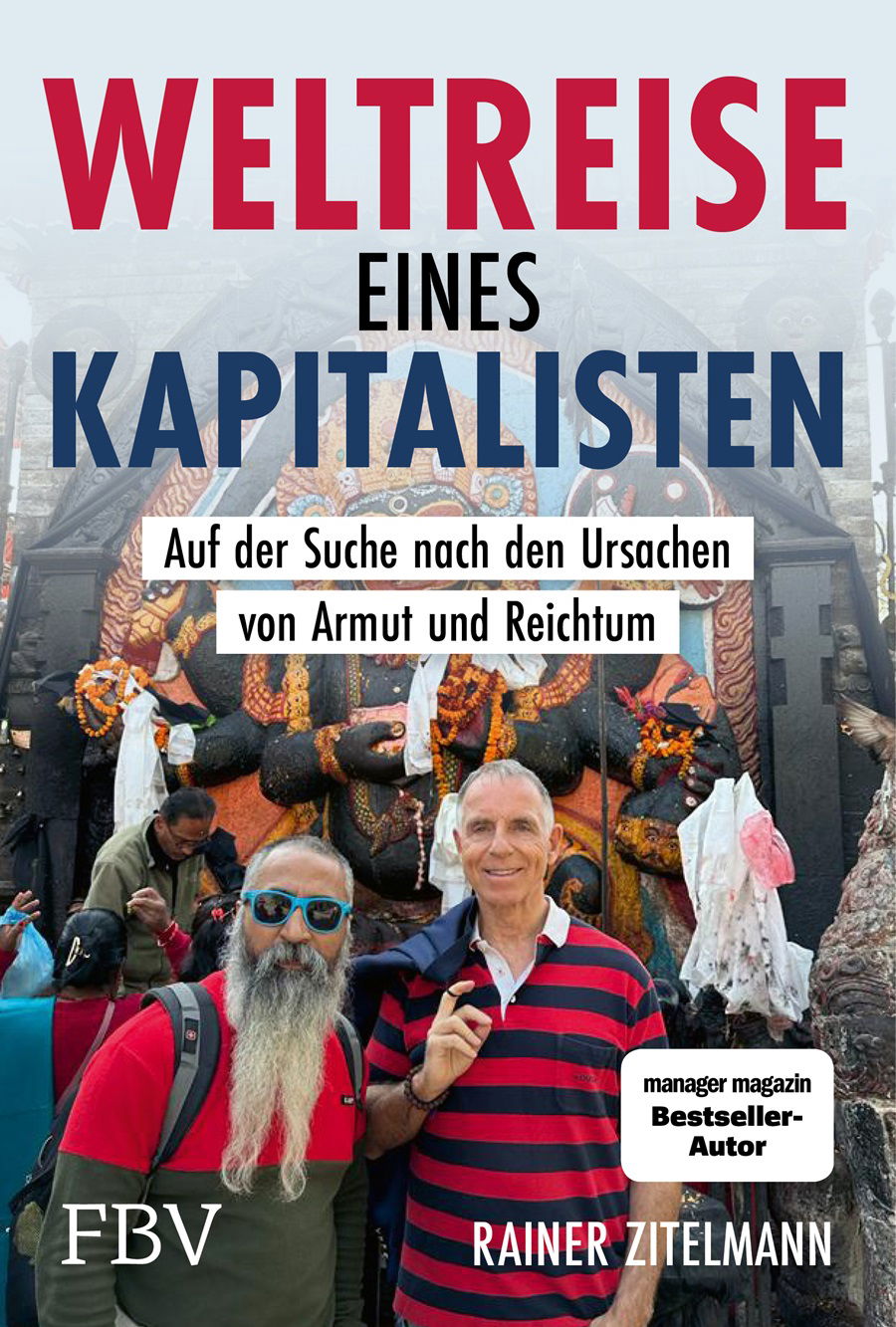
Zu meinem Vortrag in Washington kam auch Ralph Benko, der seit ein paar Jahren alle meine englischen Beiträge postet und verbreitet. Er hat 2020 die Schrift »The Capitalist Manifesto: The End of Class Warfare, Toward Universal Affluence« verfasst. Benko kennt die libertäre Szene in den USA sehr gut, sieht sie aber kritisch. Er meint, ich selbst brauche jemanden, der meine Aktivitäten nachhaltig mit erheblichen Mitteln finanziell unterstützt. Richtig ist, dass ich das, was ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, nämlich all meine Forschungen sowie die Vortragsreisen privat aus eigenen Mitteln zu finanzieren, dauerhaft nicht werde leisten können. Aber ich kenne leider keinen Unternehmer, der mir das Geld geben würde. Vielleicht hat ja ein Leser eine Idee?
Zwei Wochen nach dem Treffen veröffentlichte Benko in dem Medium »Newsmax« einen sehr schmeichelhaften Artikel über mich und mein Buch und nannte mich »den amtierenden öffentlichen intellektuellen Verfechter des Kapitalismus. Er ist der Thomas Piketty des Kapitalismus. Die Werke des Antikapitalisten Piketty werden ausgiebig besprochen und stehen auf den Bestsellerlisten. Zitelmanns Arbeit ist rigoros datengestützt. Nicht dogmatisch. Auch wenn sich die Linke eine gute Geschichte, clevererweise, nie durch Fakten verderben lässt, so werden ihre Argumente von Zitelmann vollständig demontiert. Alle (im doppelten Sinne) rechtdenkenden Menschen sollten ihn enthusiastisch unterstützen.«
Am zweiten Tag in New York schreibe ich John Fund, den ich auf dem Freedom Fest in Las Vegas kennengelernt habe, und frage ihn, ob er Zeit für ein Treffen habe. Er ist einer der wichtigsten Journalisten in der libertären Szene der USA und hat 26 Jahre für das »Wall Street Journal« geschrieben. Heute arbeitet er unter anderem für das libertärkonservative Magazin »National Review«. Wir trafen uns um 17 Uhr und sprachen fast fünf Stunden. Er erzählte mir viele Geschichten über Personen, die mich interessieren, so etwa über Arnold Schwarzenegger oder Donald Trump. Ich habe den Eindruck, er kennt so ziemlich jeden, der irgendwie wichtig ist in den USA. Eine beeindruckende Persönlichkeit.
Warum sind Antikapitalisten erfolgreicher als wir?
In New York treffe ich Mary O’Grady. Sie arbeitet seit 28 Jahren beim »Wall Street Journal«, der größten und wichtigsten prokapitalistischen Zeitung, die es gibt (die »Financial Times« ist eher kapitalismuskritisch). Die zentrale Frage, die nicht nur sie, sondern auch mich bewegt: Warum sind die Antikapitalisten so viel erfolgreicher als wir?
Sie meinte: »Wir argumentieren, das BIP pro Einwohner ist um x Prozent gestiegen, und die erzählen die herzzerreißende Geschichte einer Familie, deren Kinder in Armut leben …« Wir müssten lernen, viel emotionaler zu werden: Sie war in Kuba, und das schlimme Schicksal der Menschen dort hat sie sehr beeindruckt: Das müsste man verfilmen, die Menschen wissen einfach nichts darüber.
Am gleichen Abend findet das Treffen mit Steve Forbes statt, das Elizabeth Ames vermittelt hatte. Forbes ist seit Jahrzehnten die bekannteste Persönlichkeit in der libertären Szene der USA. Wir treffen uns in einem italienischen Restaurant in der 54. Straße und sprechen über viele Menschen, die er persönlich kennt, und ich bin interessiert zu hören, was er über sie denkt. So wie ich, ist er kein Trump-Fan. Er erzählt, Trump habe ihn jedes Jahr angerufen, wenn das »Forbes«-Ranking der reichsten Menschen erschien, weil er behauptet, viel reicher zu sein, als das Ranking es ausweist. Aber belegen konnte Trump das nie. Es zeigt jedoch den kulturellen Unterschied zwischen den USA und Deutschland: In den USA macht sich Trump viel reicher, als er ist, weil er glaubt, das könne ihm nützen. In Deutschland macht sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz viel ärmer, als er ist, weil er glaubt, dass es ihm schade, wenn publiziert werde, dass er mehrfacher Millionär ist.
Dr. Dr. Rainer Zitelmann kommt gerne auch zu Ihnen und hält einen Vortrag über seine Weltreise. Anfragen: Office-zitelmann@web.de
Von New York geht es nach Boston, wo ich vom Intercollegiate Studies Institute zu zwei Vorträgen eingeladen bin, an der Northeastern University sowie am Boston College. Das Intercollegiate Studies Institute wurde 1953 gegründet und veranstaltet jährlich etwa 100 bis 150 Vorträge an Universitäten mit Gastdozenten aus dem libertären und konservativen Umfeld. Auf meine Frage, ob solche Veranstaltungen nicht öfter von Linken gestört würden, meint Thomas Sarrouf, der mich eingeladen hat, das sei insbesondere der Fall, wenn es um Themen wie »Transgender« gehe. Man kann diese Leute, auch wenn man ihre Meinungen nicht immer teilt, für ihre Standfestigkeit nur bewundern, denn an den Unis befinden sie sich wie im Feindesland.
Auch bei Rechtskonservativen starke Ressentiments gegen Reiche und »Big Business«
Ich merke immer wieder in Gesprächen mit Trump-Anhängern und Rechtskonservativen in den USA, dass es auch bei ihnen starke Ressentiments gegen Reiche und »Big Business« gibt. Thomas Sarrouf meint, dass die meisten Milliardäre heute die Demokraten unterstützten und viele Unternehmen die »woke«-Ideologie teilten. Auch in den Radiointerviews, die ich täglich führe, ist oft dieser Affekt zu spüren: Kapitalismus ja, Big Business nein.
Am Abend des 5. April lädt Deroy Murdock – der bekannte libertärkonservative Publizist, den ich zuletzt in New York kennengelernt hatte – zu einem Dinner mit der Vorstellung meines Buches »In Defense of Capitalism« ein. Gekommen sind 20 hochrangige Vertreter konservativer und libertärer Medien, unter anderem James Taranto, der verantwortlich für die Meinungsseite beim »Wall Street Journal«
ist, Steve Forbes vom »Forbes«-Magazin, Liz Peek von Fox News, John Fund von »National Review«, James T. C. Moore, der Vizepräsident des Medienunternehmens »Newsmax«, Kelly Torrance von der »New York Post« und Guy Benson von townhall.com. Ich stelle mein Buch vor, und danach diskutieren wir zwei Stunden darüber. Solche Gelegenheiten sind Gold wert, um wichtige Kontakte zu knüpfen. Ich lerne
Stück für Stück die wichtigsten Protagonisten der libertären und konservativen Medienszene in den USA kennen.
John Fund hilft mir, den Kontakt zu Roger Kimball herzustellen, den Herausgeber von »The New Criterion« und Verleger von Encounter Books. Ich treffe mich mit Kimball, der zugleich ein sehr politischer Mensch, aber auch ein Kunstexperte ist. Er verkörpert für mich den Typus des konservativ-libertären Intellektuellen, von denen es nicht so viele gibt. Ich finde auch im Gespräch mit ihm etwas, das mir in den USA immer wieder begegnet: die scharfe Kritik an den großen Unternehmen in den USA, die als Gegner wahrgenommen werden, weil sie mit Milliardenbeträgen Gruppen wie »Black Lives Matter« und andere linke Organisationen unterstützen.
Die Medien zitieren gern kritische Äußerungen über den Kapitalismus von Hedgefonds-Manager George Soros und anderen reichen Amerikanern, die danach verlangen, höher besteuert zu werden. Aber sind das nicht Ausnahmen? Vermutlich ja, denn der öffentliche Druck gegen pro-kapitalistische und für linke Positionen ist so stark, dass sogar Milliardäre davon betroffen sind – und oft lieber schweigen. Während die Stimmen von Kapitalismuskritikern wie Benioff, Soros oder Tom Steyer lautstark zu hören sind, melden sich die Befürworter des Kapitalismus nur selten öffentlich zu Wort.
Die Politisierung des Business wird ein immer größeres Problem
Die amerikanischen Politikwissenschaftler Benjamin Page and Martin Gilens sprechen in ihrem Buch »Democracy in America?« über die »public silence of most billionaires«.
»Das öffentliche Schweigen der meisten Milliardäre«, so Page und Gilens, »steht im krassem Gegensatz zur Bereitschaft einer kleinen, atypischen Gruppe von Milliardären – darunter Michael Bloomberg, Warren Buffett und Bill Gates –, sich zu bestimmten politischen Themen öffentlich zu äußern … Alle drei haben sich für ein umfangreiches soziales Sicherheitsnetz, progressive Steuern und eine moderate Regulierung der Wirtschaft ausgesprochen. Ein amerikanischer Normalbürger, der Bloomberg, Buffett oder Gates zuhört und dabei versucht, sich ein Urteil über das politische Denken und Tun von US-Milliardären zu bilden, würde schwer in die Irre geführt werden.«
Ich habe bisher Äußerungen wie die oben zitierten von Benioff oder Dalio oder von dem mächtigen Blackrock-Gründer Larry Fink für Außenseiterpositionen gehalten. Aber das Buch von Stephen R. Soukup gibt mir zu denken. »Aktivisten« in den USA beschränken sich nicht mehr darauf, die Redefreiheit an Universitäten niederzuschreien (Cancel Culture), sondern sie sind längst in der Finanzwirtschaft angekommen. Politischer Aktivismus auf Hauptversammlungen von Unternehmen kommt fast immer von links – die Zahl derer, die sich dem aktiv widersetzen, könne man an einer Hand abzählen.
Und die Politisierung des Business wird ein immer größeres Problem. Sogar jemand wie Warren Buffett, der selbst moderat links steht, hat schon 2019 vor der Politisierung der Wirtschaft und der Finanzindustrie gewarnt. »Es war von Unternehmen nicht richtig«, sagte er in einem Interview mit der »Times«, »der Gesellschaft ihre eigenen Ansichten über ›Gutes tun‹ aufzuzwingen. Wieso glaubten sie, es besser zu wissen?« Er fügte hinzu: »Es ist das Geld der Aktionäre. Viele Unternehmenslenker beklagen, dass die Regierung das Geld der Steuerzahler verteilt, verteilen aber selbst mit Begeisterung das Geld der Aktionäre.«
ESG, »Environmental, Social und Governance« ist längst mehr als ein Modewort. Es ist zur Parole geworden, mit der sogenannte Aktivisten, aber auch Fondsmanager und Unternehmensführer bestimmte Vorstellungen von »Nachhaltigkeit«, »Diversity« usw. durchsetzen. Die Stichwortgeber sind linke Ideologen, die überall »Rassismus« oder »Sexismus« wittern, aber viele Unternehmen haben inzwischen kapituliert. Vermutlich haben sich die Manager zuerst äußerlich angepasst, und dann folgte die innerliche Anpassung. In der Psychologie nennt man das »kognitive Dissonanz«: Menschen halten es nicht lange aus, anders zu sprechen, als sie denken. Zuerst übernehmen sie linke Parolen aus Opportunismus und Bequemlichkeit, schließlich passen sie die innere Haltung der äußeren an.
Milliardäre wie Jeff Bezos oder Apple-Chef Tim Cook haben viele Millionen für »social justice organizations« wie Black Lives Matter gespendet – nicht selten vom Geld ihrer Aktionäre! Viele Manager und Unternehmer hoffen, sich freizukaufen und von Kampagnen linker »Aktivisten« verschont zu werden, wenn sie Millionenbeträge an linke Organisationen spenden oder öffentliche Kritik am Kapitalismus äußern und sich für höhere Steuern für die Reichen aussprechen. Aber die Rechnung geht keineswegs immer auf. Wer einmal Erpressern nachgibt, von dem werden künftig immer größere Summen gefordert.
Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist Historiker und Soziologe – und war auch als Unternehmer und Investor erfolgreich. Er hat 29 Bücher geschrieben und herausgegeben, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden (zuletzt “Weltreise eines Kapitalisten“, “Der Aufstieg des Drachen und des weißen Adlers: Wie Nationen der Armut entkommen“, “Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten“). In den vergangenen Jahren schrieb er Artikel oder gab Interviews in führenden Medien wie Wall Street Journal, Times, Le Monde oder Corriere della Sera. Seit kurzem kann auch eine Master-Class “Finanzielle Freiheit – Schluss mit der Durchschnittsexistenz” belegt werden. Bei dem vorliegenden Beitrag handelt sich hier um einen von der Redaktion stark gekürzten Auszug aus Rainer Zitelmanns neuestem Buch, das insgesamt 41 Kapitel enthält.























Schreibe einen Kommentar