
Wohlstand und Armut von Nationen
Was ist der Schlüssel, zu verstehen, wie Nationen der Armut entkommen? Es ist die Erkenntnis, dass “Entwicklungshilfe” bzw. “Entwicklungszusammenarbeit” nach vorherrschenden Modellen nicht zum Erfolg führt. Vielmehr zeigt der Blick auf Länder wie Polen oder Vietnam, aber auch abschreckende Beispiele wie Argentinien oder Venezuela, dass Armut nicht durch Umverteilung überwunden wird, sondern durch kapitalistische Reformen.
Von Dr. Dr. Rainer Zitelmann
»Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.« Dieses Zitat wird oft Albert Einstein zugeschrieben, obwohl kein Beleg existiert, dass er das wirklich gesagt hat. Aber natürlich stimmt die Aussage. 50 Jahre Entwicklungshilfe und über 100 Jahre Erfahrungen mit sozialistischen Experimenten haben gezeigt, dass Armut nicht durch Umverteilung überwunden wird.
In der Welt der Wirtschaft lernen Firmen von den Besten – im BWL-Jargon heißt das treffend »Best Practice«. Auch Nationen können voneinander lernen. In meinem neuen Buch zeige ich am Beispiel von Polen und Vietnam, wie Nationen der Armut entkommen. Trotz schrecklicher Zerstörungen durch Krieg und Sozialismus haben es diese Länder geschafft, mehrere Jahrzehnte lang den Lebensstandard der
Menschen Jahr für Jahr zu verbessern. Das Rezept war in beiden Fällen ähnlich: kapitalistische Reformen.
Aber solche Reformen können nicht einfach von oben verordnet werden. In Polen und Vietnam hatten sich schon in der sozialistischen Zeit im Untergrund marktwirtschaftliche Strukturen herausgebildet. In Polen gab es, wie in allen sozialistischen Ländern, eine umfangreiche Schattenwirtschaft, ohne die die Menschen nur schwer hätten überleben können. Der Schwarzmarkt entstand parallel zum offiziellen Konsumgütermarkt, und obwohl diese Praktiken strafbar waren, wurden sie von der Partei geduldet.
Kapitalismus kann nicht von oben verordnet werden
In Vietnam hatten sich, ähnlich wie in China, schon vor Beginn der Reformen informelle Marktstrukturen herausgebildet. Teilweise legitimierten die Reformen nur, was schon zuvor als spontane Entwicklung in vielen Dörfern stattgefunden hatte. Viele landwirtschaftliche Kollektive und sogar Staatsbetriebe ignorierten die offiziellen staatlichen Bestimmungen und Regulierungen. Sie weigerten sich, in Kollektiven zu arbeiten, und schlossen unerlaubte Verträge (»khoan chui«) zwischen Kollektiven und Familien oder zwischen Staatsbetrieben und privaten Händlern ab. Diese Praxis wurde als »Überwindung der Zäune« (»pha rao«) bezeichnet.
Kapitalismus kann nicht von oben verordnet werden. Das Beste, was die politische Führung tun kann, ist, sich den spontanen Entwicklungen nicht entgegenzustemmen, sondern einen legalen Rahmen dafür zu schaffen, der Rechtssicherheit bringt.
“Dass Menschen Reichtum nicht vor allem mit negativen Gefühlen und Neid betrachten, sondern dass sie selbst den Drang haben, reich zu werden, ist eine Voraussetzung dafür, dass wirtschaftliche Dynamik in einem Land entsteht”
Sowohl in Polen als auch in Vietnam gab es zahllose Versuche, den Sozialismus zu verbessern und zu »reformieren«. Aber spätestens Ende der 80er-Jahre erkannten die Menschen, dass eine systemimmanente Reform nicht möglich ist. Vietnam bezeichnet sich zwar bis heute als »sozialistisches« Land und die Staatspartei nennt sich kommunistisch. Doch findet man in Vietnam weniger überzeugte Marxisten als in den USA und Europa. In Polen kam es, anders als in Vietnam, zu einem Bruch auch mit dem alten politischen System. Neben Unterschieden gibt es aber mehr Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ländern. Sozialneid ist in Vietnam und Polen nur wenig verbreitet.
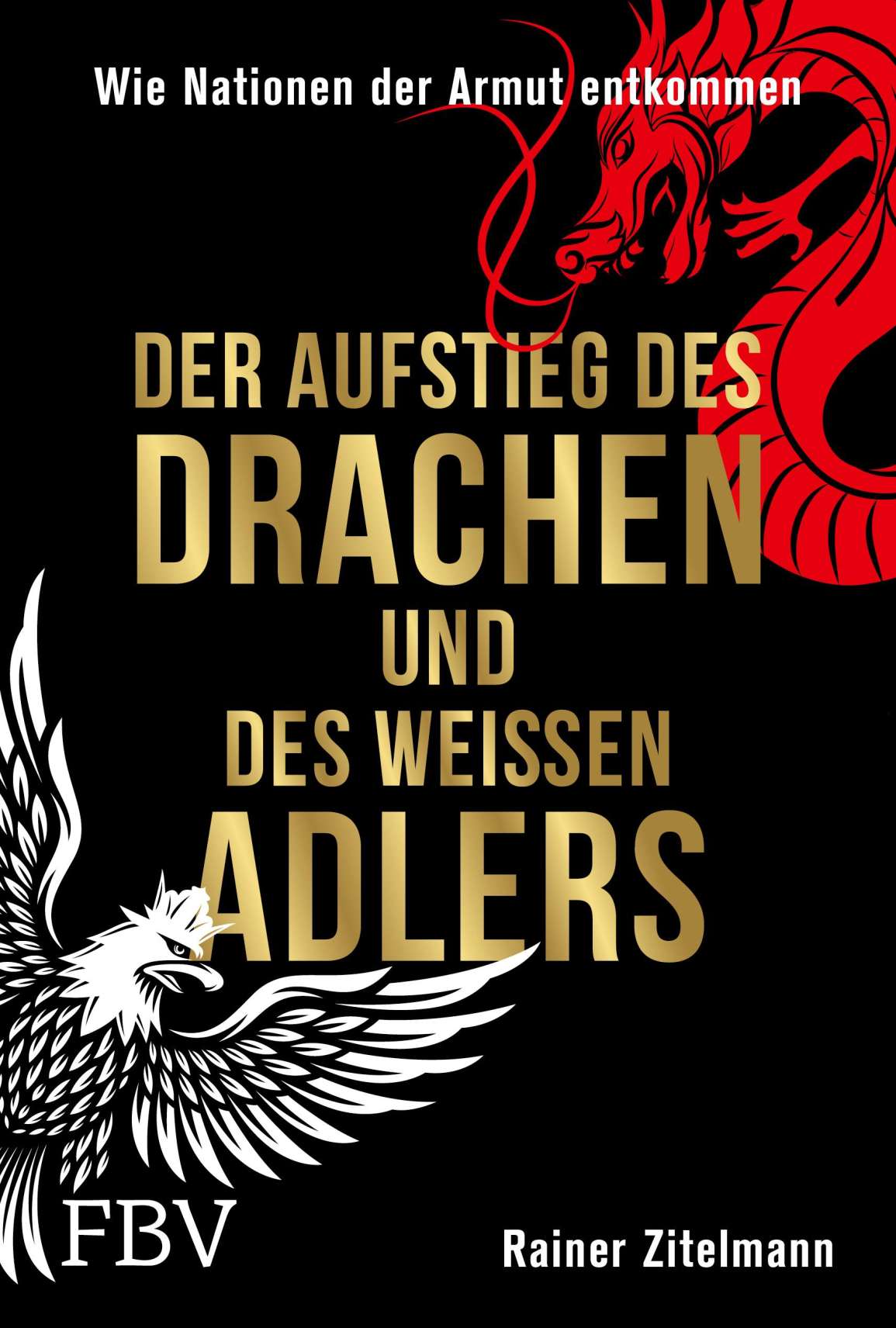
Der Rich Sentiment Index, den ich für 13 Länder auf Basis umfassender Umfragen erhoben habe, zeigt, dass die positivste Sicht auf reiche Menschen die Bevölkerungen in Polen und Vietnam haben. Dass Menschen Reichtum nicht vor allem mit negativen Gefühlen und Neid betrachten, sondern dass sie selbst den Drang haben, reich zu werden, ist eine Voraussetzung dafür, dass wirtschaftliche Dynamik in einem Land entsteht. In 13 Ländern haben wir die Menschen gefragt, wie wichtig es ihnen ist, reich zu werden. In Deutschland sagten 22 Prozent, ihnen sei das wichtig, in den USA waren es 30 Prozent, in Polen 49 Prozent, in China 50 Prozent, in Südkorea 63 Prozent und in Vietnam sogar 76 Prozent.
Nationen, die verarmen
Das Buch handelt von Nationen, die der Armut entkommen sind, aber es lohnt ein Blick auch auf Nationen, die verarmen. Es gibt vermutlich kein Land auf der Welt, das in den letzten 100 Jahren so dramatisch abgestiegen ist wie Argentinien. Anfang des 20. Jahrhunderts war das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung eines der höchsten der Welt. Der Ausdruck »riche comme un argentin« – reich wie ein Argentinier – war damals ein geflügeltes Wort.
Der Abstieg Argentiniens ist mit einem Namen eng verbunden – Oberst Juan Domingo Perón. Im Februar 1945 wurde er zum Präsidenten gewählt. Seine erste Amtszeit dauerte bis 1955. Sein Programm: mehr Staat. Die Telefongesellschaft wurde verstaatlicht, die Eisenbahn, die Energieversorgung, der private Rundfunk. Allein zwischen 1946 und 1949 verdreifachten sich die Staatsausgaben. Die Zahl der Staatsbediensteten stieg von 243.000 im Jahr 1943 auf 540.000 im Jahr 1955 – viele neue Jobs in Behörden und im öffentlichen Dienst wurden geschaffen, um die Anhänger von Peróns Arbeiterpartei zu versorgen. Die Wirtschaftspolitik war sozialistisch: Obwohl das Passagier- und Frachtaufkommen für die Eisenbahn stagnierte, stieg zwischen 1945 und 1955 die Zahl der Beschäftigten um mehr als die Hälfte. Die peronistischen Gewerkschaften wurden neben dem Militär zur mächtigsten Organisation in Argentinien. Wie eine Heldin wurde Peróns Frau Eva Duartes verehrt, die mit vollen Händen das Geld für Soziales ausgab.
Militärdiktaturen und peronistische Regierungen lösten sich ab, Argentinien versank immer mehr in Schulden. 1973 kam Perón ein drittes Mal an die Macht – und wieder bestand sein Programm aus Umverteilung und starker staatlicher Regulierung. Von 1976 bis 1983 wurde Argentinien von den Militärs regiert, die Oppositionelle brutal verfolgten.
Wirtschaftlich ist die Geschichte Argentiniens eine Geschichte von Inflation, Hyperinflation, Staatspleiten und Verarmung. Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1816 erlebte das Land neun Staatskonkurse, den letzten im Jahr 2020. Eine tragische Geschichte für ein so stolzes Land, das einmal zu den reichsten der Welt zählte. Ich habe dieses Land besucht und mit einfachen Menschen, Ökonomen und Politikern gesprochen. Meine Beobachtung: Mehr und mehr Menschen dort erkennen, dass eine Lösung ihrer Probleme und ein Weg aus der Armut heraus nur durch mehr Kapitalismus möglich sein wird.
Geschichte ist kein Hollywood-Film mit garantiertem Happy Ending
Ein anderes trauriges Beispiel für den Abstieg einer Nation ist Venezuela. War es zu Beginn des 20. Jahrhunderts eines der ärmsten Länder in Lateinamerika, so hatte Venezuela bis Ende der 1960er-Jahre eine erstaunliche Entwicklung genommen. 1970 war es das reichste Land Lateinamerikas und eines der 20 reichsten Länder der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf war höher als das von Spanien, Griechenland oder Israel und nur 13 Prozent niedriger als das von Großbritannien.
Der Abschwung begann in den 70er-Jahren. Einer der Gründe für die Probleme war die Fixierung auf die enormen Vorräte an Erdöl. Es kamen weitere Ursachen hinzu, insbesondere ein ungewöhnlich hoher Grad an staatlicher Regulierung des Arbeitsmarktes, die seit 1974 durch immer neue Vorschriften verschärft wurde. In kaum einem anderen Land Lateinamerikas (und weltweit) war der Arbeitsmarkt mit einem so engmaschigen Netz von Regulierungen überzogen. Während die Unternehmen 1972 noch das Äquivalent von 5,35 Monatslöhnen für die Lohnnebenkosten zahlen mussten, hatte sich diese Zahl bis 1992 auf 8,98 Monatslöhne massiv erhöht. Aber, auch dies zeigt das Beispiel Venezuela: Wenn die Probleme immer größer werden, führt dies keineswegs zwingend dazu, dass die Menschen lernen – Geschichte ist eben nicht wie ein Hollywood-Film mit garantiertem Happy Ending. Oder, um es anders zu sagen: Schlimmer geht immer.
“Auch wohlhabende demokratische Länder sind nicht dagegen gefeit, binnen weniger Jahre ihren Wohlstand und ihre Freiheit zu verlieren”
Viele Menschen in Venezuela hofften, der charismatische Sozialist Hugo Chávez würde die Probleme des Landes lösen. Chávez wurde 1998 zum Präsidenten gewählt. 1999 rief er die »Bolivarische Republik Venezuela« aus. Er war nicht nur Hoffnungsträger für viele arme Menschen im Land, sondern er entfesselte die Utopiesehnsüchte der Linken in Europa und Nordamerika mit der Parole vom »Sozialismus im 21. Jahrhundert«. Das Ende kennen wir: Venezuela verlor zuerst die wirtschaftliche, dann die politische Freiheit. Die Inflation stieg zwischenzeitlich auf absurde 1 Million Prozent, die Menschen litten Hunger, Millionen sind schon aus dem Land geflüchtet.
Die Geschichte Venezuelas sollte uns eine Warnung sein: Auch wohlhabende demokratische Länder sind nicht dagegen gefeit, binnen weniger Jahre ihren Wohlstand und ihre Freiheit zu verlieren. Freiheit, wirtschaftliche wie politische, ist nicht selbstverständlich, sondern muss immer wieder neu erkämpft werden.
Auch in Polen und Vietnam ist es nicht selbstverständlich, dass der Weg, der seit Ende der 80er-Jahre beschritten wurde, weiterverfolgt wird. Oft vergessen die Menschen nach einer gewissen Zeit, warum ihr Land erfolgreich wurde. In Polen gibt es heute eine gefährliche Tendenz zu mehr Staat und weniger Markt. In Vietnam ist eine solche Tendenz bisher nicht zu erkennen. Doch ohne politische Reformen wird es in Vietnam letztlich nicht möglich sein, Probleme wie etwa die Korruption erfolgreich zu bekämpfen.
Ich bewundere beide Länder und hoffe, dass sich die Menschen in vielen heute armen Ländern ein Beispiel an ihnen nehmen. Ich möchte ihnen zurufen: Hört auf, euch mit der Vergangenheit zu befassen und nach Schuldigen im Westen zu suchen, hört auf, zu glauben, der Westen könne euch mit »Entwicklungshilfe« aus der Armut befreien. Studiert die Geschichte von Polen und Vietnam, denn sie enthält den Schlüssel, zu verstehen, wie Nationen der Armut entkommen!
Mehr von Rainer Zitelmann:
- „Wir haben vergessen, wodurch und warum wir erfolgreich wurden“
- Interview: Geld und Vermögen in Corona-Zeiten
- Blogseite von Dr. Dr. Rainer Zitelmann
Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist Historiker und Soziologe – und war auch als Unternehmer und Investor erfolgreich. Er hat 26 Bücher geschrieben und herausgegeben, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Sein neuestes Buch soll in 20 Sprachen erscheinen. In den vergangenen Jahren schrieb er Artikel oder gab Interviews in führenden Medien wie Le Monde, Corriere della Sera, Il Giornale, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Neue Zürcher Zeitung, Daily Telegraph, Times und Forbes.























Schreibe einen Kommentar