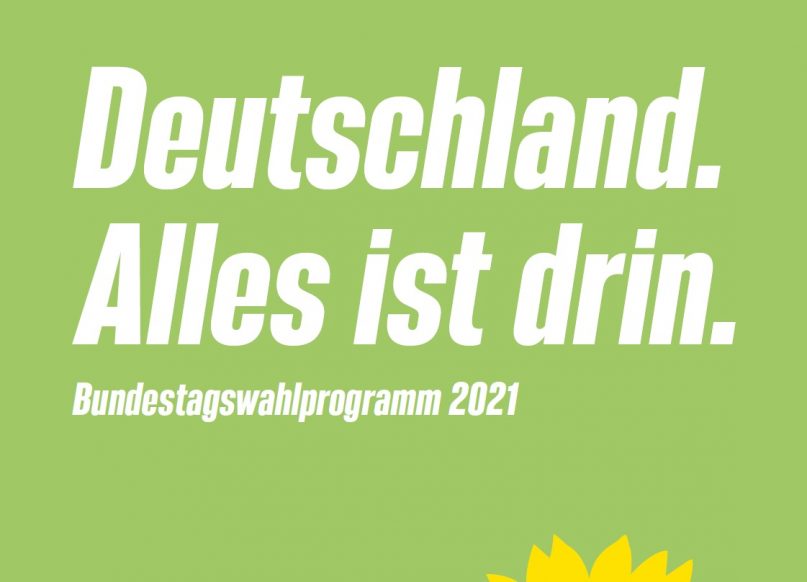
Wahlprogramme 2021 im Sprach-Check: Bündnis90/Die Grünen
Exklusiv für DDW Die Deutsche Wirtschaft wurde das Grünen-Wahlprogramm von den beiden Sprachexperten Armin Reins und Géza Czopf einer sprachlichen Analyse unterzogen.
Zur Gesamtübersicht
Das Grünen-Wahlprogramm lautet „Deutschland. Alles ist drin“. Umgangssprachlich bedeutet „alles drin“, dass eben auch das Scheitern drin ist. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf dieses Wahlprogramm.
Nett ist der Einfall, das Programm mit „Eine Einladung“ zu beginnen. Die Leser werden jedoch gesiezt, von den Grünen hätte man eher ein Du erwartet. Im Entwurf wählten sie noch die Paarform, in der letzten Fassung hat sich dann doch die Schreibweise mit Gendersternchen durchgesetzt. Allerdings mit Problemstellen. „Landwirt*innen“ werden meist durch „Bäuer*innen“ ersetzt. Hier offenbart sich eine Tücke von Gender-Schreibweisen. Der Begriff Bäuerin bezieht sich nur auf weibliche Personen und wird dennoch zusätzlich gegendert. Warum bleiben die Grünen aber nicht bei Landwirt*innen? Da es doch bekannt ist, dass der Begriff „Bauer“ im Allgemeinen als pejorativ (herabwertend) wahrgenommen und häufig als Schimpfwort verwendet wird. Bei „Handwerker*innen“ lautet der Singular dann auch schon einmal „Handwerkerin“. Ohne Genderstern. Ein Versehen?
Noch schwieriger wird es bei den Mitmenschen jüdischen Glaubens, die in der Paarform als „Jüdinnen“ und „Juden“ bezeichnet werden. Hier liegt der Grund möglicherweise in einem Kommentar von Ellen Presser vom 11. März 2021 in der Jüdischen Allgemeinen. Sie verwehrt sich darin, „auf neue Weise einen Stern verpasst“ zu bekommen. Auch Wörter wie „Judenfeindlichkeit“ und „Judenhass“ werden nicht gegendert.
Bei der muslimischen Glaubensgemeinschaft ist hingegen wieder von „Muslim*innen“ die Rede ist. Die Begriffe „Sinti*zze“ und „Rom*nja“ zeugen von perfektem Gendergebrauch, aber ob sie auch praktikabel sind? Solche Wortkreationen dürften kaum in der Alltagssprache verwendet werden, auch nicht von den angesprochenen Personengruppen selbst. Und dann gibt es interessante Wörter wie „Pandemieleugner*innen“ oder „Imam*innen-Ausbildung“. Interessanterweise wurden die Wörter „Makler“ und „Maklerprovisionen“ nicht gegendert. Dabei dürfte es deutlich mehr „Makler*innen“ als „Imam*innen“ geben.
Was den Wortschatz angeht, ist wirklich alles drin, was eine ökologische Partei mit sozialistischer Färbung ausmacht. Unzählige Male fallen die Schlüsselbegriffe „klimaneutral“ und „klimagerecht“. Und auch sonst dreht sich im Grünen-Wahlprogramm fast alles um „Klimaschutz“, um die „Klimakrise“ oder „Klimakatastrophe“. Die „rein auf Profit ausgerichtete Wirtschaft“ wird abgelehnt und eine „vielfältige Einwanderungsgesellschaft“ angestrebt.

Wie die „sozial-ökologische Neubegründung unserer Marktwirtschaft“ vonstatten geht, verraten sie unter dem Kapitel „Energiegeld einführen“:
„Wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorziehen. Danach soll der CO2-Preis so ansteigen, dass er im Konzert mit den Fördermaßnahmen und ordnungsrechtlichen Vorgaben die Erreichung des neuen Klimaziels 2030 absichert.“
Trotz des Bürokratenjargons ist die Botschaft eindeutig. Strom wird noch teurer. Zur Erinnerung sei nochmal auf die aktuelle Faktenlage hingewiesen: Seit der Jahrtausendwende hat sich der Strompreis hierzulande mehr als verdoppelt. Der Strom ist in Deutschland durchschnittlich 163 Prozent teurer als im Rest der Welt.
Das nachfolgende Kapitel „Schneller raus aus der Kohle“ erhält so eine bitter-böse Doppeldeutigkeit. Wie das Energiegeld funktioniert, wird auch erklärt:
„Über das Energiegeld geben wir alle zusätzlichen Einnahmen transparent an die Menschen zurück und entlasten sie direkt, indem sie eine Rückerstattung pro Kopf bekommen. So wird klimafreundliches Verhalten belohnt und es findet ein sozialer Ausgleich im System statt. Unterm Strich werden so Geringverdiener*innen und Familien entlastet und vor allem Menschen mit hohen Einkommen belastet.“
Das Diffizile daran ist nur, dass an dieser Stelle nicht gesagt wird, ab welchem Einkommen Menschen laut der Grünen ein hohes Einkommen beziehen.
Dass die Grünen gesellschaftspolitisch am großen Rad drehen wollen, sprechen sie in ihrem Programm auch aus. Im Vagen bleibt jedoch immer, auf was sich die Menschen in Deutschland dann einzustellen haben. So heißt es:
„Die Klimakrise und die Endlichkeit von Ressourcen verlangen ein Umsteuern. Zugleich ist unser Verständnis von dem, was Wohlstand ist, im Wandel“.
Hier wäre es nützlich zu erfahren, was die Grünen künftig unter Wohlstand verstehen. Sicher ist nur: Der Staat wird bei der „neuen wirtschaftlichen Dynamik“ den Takt vorgeben:
„Dafür ist eine Politik nötig, die will, die nach vorne führt und verlässlich steuert. Nicht weil der Staat besser wirtschaften kann, sondern weil die Wirtschaft klare Verhältnisse, verlässliche politische Rahmen-bedingungen und Anreize braucht.“
Ob das die Wirtschaft wohl auch so sieht, dürfte fraglich sein. Denn was nach massiven staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft klingt, ist auch so gemeint:
„Wir schaffen Anreize, streichen umweltschädliche Subventionen und setzen ordnungspolitische Regeln, damit nachhaltig produziert, gehandelt und konsumiert wird.“ Das „eigentliche Ziel von Politik“ sei es „klimagerechten Wohlstand“ neu zu berechnen.
Auch hier lautet aber die Frage: Was ist ein „klimagerechter Wohlstand“?
Von den Grünen müsste man eine gefühls- sowie trendorientierte Sprache erwarten. Das löst der Text aber nicht ein. Die einzelnen Kapitel im Grünen-Wahlprogramm sind regelrechte Textwüsten. Die Sprache gibt sich manchmal gespreizt („reaktive Politik“) und manchmal pathetisch („In kurzer Zeit eine klimaneutrale Gesellschaft zu werden, ist eine epochale Aufgabe mit inspirierender Kraft“). Dann ist sie wieder kompliziert („Rebound-Effekte gilt es generell zu vermeiden, Suffizienz zu unterstützen“) und manchmal sind es nur Leerformeln („Wir haben erfahren, wie begrenzt nationale Antworten auf globale Fragen sind, gesehen, wie viel Unsicherheit entsteht, wenn man nur auf Sicht fährt, und wie notwendig eine Politik mit Weitblick ist“). Insofern steckt sprachlich hier tatsächlich alles drin.
Am meisten verwundert aber, dass der progressive Wille so oft in eine konservative Beamtensprache gekleidet wird: lange Sätze, Nominalstil, Behördenjargon. Vor allem bei heiklen Themen drängt sich ein Vernebelungsverdacht auf. So wie hier, wenn es um den Abstand von Windrädern zu Wohngebieten geht:
„Exzessive, pauschale Mindestabstände zu Siedlungen leisten keinen Beitrag zur Akzeptanzsteigerung.“
Fairerweise muss aber hinzugefügt werden: Generell ist bei allen Parteien zu vermerken, dass sie auf der Einleitungs- und Image-Ebene auf eine verständlichere Sprache zurückgreifen als in den unteren Ebenen, in denen es um konkrete Inhalte geht. Sobald die Botschaften bei ihnen komplexer werden, wird es auch die Sprache. Zudem heißt verständlicher nicht immer auch aussagekräftiger. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich viele dieser Sätze als Phrasen und Leerformeln.
Die Grünen haben sich selbst das Kapitel „Für eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft“ in das Programm geschrieben, das auch „schwer lesbare Webseiten“ umfasst. Doch Gender-Sätze wie
„Ein*e unabhängige*r Bundestierschutzbeauftragte*r sollen Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte wahrnehmen“
sind ebenso wenig barrierefrei wie unser Lieblingssatz zum Thema Digitalisierung:
„Wir setzen uns ein für einen nach Risiken abgestuften europäischen Ordnungsrahmen für den Einsatz automatischer Systeme, klare Regeln zur Nachvollziehbarkeit, zum Datenschutz, zum Arbeitsrecht und zur Datenqualität, um Kontrolle und Haftung, aber auch Rechtssicherheit für betroffene Betriebe zu ermöglichen“.























Schreibe einen Kommentar