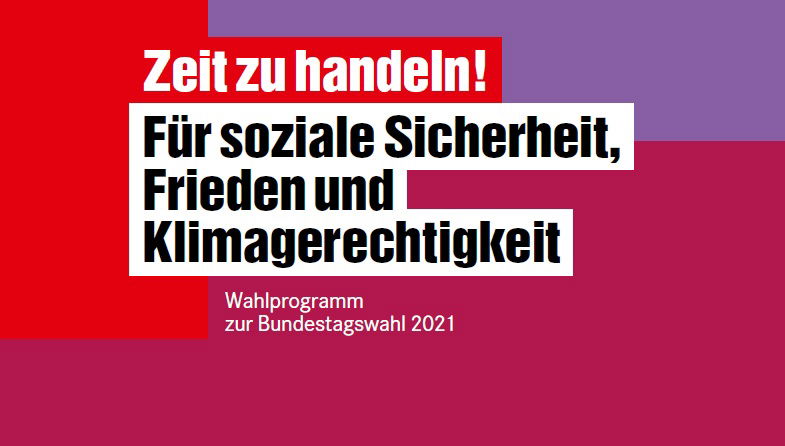
Wahlprogramme 2021 im Sprach-Check: Die Linke
Exklusiv für DDW Die Deutsche Wirtschaft wurde das Linke-Wahlprogramm von den beiden Sprachexperten Armin Reins und Géza Czopf einer sprachlichen Analyse unterzogen.
Zur Gesamtübersicht
Werfen wir einen Blick in das Programm der Partei, die vielleicht mit der geringsten Stimmenanzahl in den Bundestag einzieht – sich aber dennoch Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung machen darf.
Das Programm von DIE LINKE trägt den Titel „Zeit zu handeln! Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit“ und die erste Überschrift der Einführung lautet
„Es kommt auf alle an. Es kommt auf dich an“.
Die Interessenten werden geduzt. Das baut Distanz ab und Nähe auf. Es soll keine Klassenunterschiede geben, unter Genossen wird eben geduzt. Die Aussage ist aus linker Sicht nichts Neues. Der – und natürlich auch die – Einzelne wird mobilisiert, um das große Ganze zu beeinflussen, um die Gemeinschaft zu stärken. Denn als sozialistische Partei betont die Linke natürlich die Bedeutung der Gemeinschaft.
Das Pronomen „wir“ ist in allen Wahlprogrammen eines der häufigsten – als Stellvertreterwort für die Partei. In diesem Fall tritt es kampfbetont zu Tage:
„Wir finden uns nicht mit diesen Verhältnissen ab und sind bereit, uns mit den Profiteuren*innen anzulegen.“
Doch während es sich bei den anderen Parteien vornehmlich auf die Absender bezieht, steht es hier oft als ein inkludierendes „wir“, als Pronomen für die Gemeinschaft. Es ist ein wichtiges Werkzeug der Umarmungstaktik:
„Wir alle können gemeinsam Deutschland demokratischer und sozial gerechter machen. Wir haben es zusammen in der Hand.“
„Solidarisch schaffen wir es.“
Dann schwenkt die Sprache wieder auf ein Du um. Das schafft Dynamik und involviert die Leser:
„Wir haben den Mut, die notwendigen Veränderungen zu wagen. Für mehr Gerechtigkeit, für Frieden und eine sichere Zukunft. Für dich. Mit dir.“
„Du hast die Wahl.“
Die Sprache soll aber nicht nur umarmen, sondern auch vereinnahmen. Daher gesellt sich zur Wir-Taktik auch noch ein ganzes Sammelsurium an Gute-Tugend-Vokabeln wie „Verlässlichkeit“, „Ehrlichkeit“, „Mut“, „Gerechtigkeit“, „Geborgenheit“, „Anerkennung“ und „sozialer Halt“. Denn die Linke verspricht:
„Wir treten dafür an, dass deine Sorgen, Wünsche und Träume in diesem Land endlich ernst genommen werden“.
So wird der Gemeinschaftsgedanke nochmals prägnant herausgestellt. Und natürlich peilt sie etwas an, was alle Parteien und Programme vereint. Ein Schlagwort ist das große Bindeglied der Ideologien. Denn alle wollen „neuen Wohlstand für alle“. Dass es diesen noch nicht gibt, hat für die Linke einen Grund:
„16 Jahre Angela Merkel haben einen Schleier über die sozialen Unterschiede gelegt, die unsere Gesellschaft so zerklüften, in Unruhe versetzen, die spalten und zu Wut und Ohnmacht geführt haben.“
An diesem Satz sieht man, dass auch das Repertoire der negativen Schlagwörter sitzt. Die Linke spricht eine einfache, bildhafte, emotionale Sprache.
Das Vokabular ist zudem ideologisch geprägt, zumindest tauchen regelmäßig wichtige Schlüsselbegriffe auf:
„Die ökologische Krise ist die große Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig ist sie eine Klassenfrage.“
„Die Umweltzerstörung ist von den sozialen Verhältnissen im Kapitalismus nicht zu trennen.“
„Die Energieversorgung muss durch erneuerbare Energien und gemeinwohlorientiert in öffentlichem und genossenschaftlichem Eigentum erfolgen.“
„Fast 2 Millionen Wohnungen stehen leer, weil das Finanzkapital aufgrund der ungleichen Verteilung des Reichtums und der Blasen auf den Finanzmärkten nach lukrativen Anlagemöglichkeiten sucht.“
Das „Finanzkapital“ ist ein typischer Begriff aus dem marxistischen Sprachgebrauch, allerdings nicht unproblematisch, da er auch häufig in antisemitischen Kontexten aufzufinden ist.
Andere Begriffe wie „Schuldturm“ (für „öffentliches Schuldnerverzeichnis“) machen die Texte plakativ. Diese plakative Darstellungsweise wird durch Fettungen und durch viele Ausrufezeichen noch verstärkt:
„Pflegende Angehörige entlasten!“, „Öffentlichen Gesundheitsdienst stärken!“, „Sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau schaffen!“
Der Tonfall bleibt über den gesamten Text kämpferisch. Schließlich möchte man den Status quo ändern:
„die Macht der Banken brechen“, „Finanzkriminalität bekämpfen“, „Steueroasen trockenlegen“.
Dabei gerät das Vokabular schon martialisch, wenn es beispielsweise heißt:
„Immobilienkonzerne an die Kette legen!“
Oder:
„Wir wollen die Gesellschaft und die Demokratie aus dem Würgegriff der Finanzkonzerne befreien.“
Im Gegensatz zu den Rechten sehen die Linken nicht nur in der Regierung einen Gegner. Sie kennen ein weiteres großes Feindbild: die Konzerne.
„In der Lebensmittelkette dominieren große Konzerne, die ihre Gewinne auf Kosten von Menschen und Umwelt machen.“
„Auch in der Klimakrise sind Konzerne die Krisengewinner.“
„Es braucht in Europa endlich höhere Steuern für Reiche und Konzerne.“
Bei allem nicht zu vergessen: Die Linke tritt auch noch immer als eine regionale Partei auf, indem sie sich als die Interessenvertretung der Ostdeutschen sieht. Daher erhält das Thema Ostdeutschland ein gesondertes Kapitel. Auch mit Geschichte weckt man Emotionen. So sind die Taten der Treuhand auch in diesem Programm noch nicht vergessen.
„DIE LINKE ist den Erfahrungen und den Kämpfen der Menschen in Ostdeutschland verbunden. Wir sind die Stimme des Ostens.“
Und fast schon poetisch:
„Mehr Posten für den Osten“.
Die Forderung ist klar:
„Der Osten soll nicht mehr die verlängerte Werkbank westdeutscher Großkonzerne sein.“
Der größte Feind der Linken sind jedoch die extremen Rechten und der Neonazismus. Bedenklich wird es aber, wenn Neonazismus als westdeutsche Praxis dargestellt wird, so als wäre die Berliner Mauer tatsächlich als antifaschistischer Schutzwall notwendig gewesen:
„Die Neonazis versuchten, den öffentlichen Raum zu dominieren, und übten die Kontrolle aus – zumindest in Stadtteilen und Wohnquartieren. Die ostdeutschen Landesregierungen waren Vorreiter einer beschämenden Verharmlosung und führten damit die gängige politische Praxis des Westens fort.“
Auf schmalem Grat wandert die Linke auch, wenn sie Verfassungsorgane in die Nähe von Neonazis rückt:
„Weil die Verfassungsschutzbehörde dem Schutz von Informanten*innen Vorrang einräumt, behindert sie immer wieder polizeiliche Ermittlungen und juristische Aufklärung – und baut extrem rechte Strukturen sogar mit auf.“
Auch wird nicht jeder die Auffassung teilen, dass ausgerechnet die Antifa für politische Aufklärung zu loben sei, so wie dies hier geschieht:
„Aufklärung und Widerstand gegen Rechts wird von anderen geleistet: Meist sind es ehrenamtlich organisierte Projekte der Zivilgesellschaft und Antifa-Initiativen, die Aufklärungsarbeit betreiben, Solidarität praktisch erlebbar machen und dahin gehen, wo es weh tut.“
Dass die Antifa dahin geht, „wo es weh tut“, ist ein unfreiwilliger Wortwitz, wenngleich nicht zum Lachen.
Als einzige Partei nennt die Linke in ihrem Parteiprogramm namentlich eine andere Partei, die sie zum Feindbild erklärt. Bleibt nur zu hoffen, dass solche Bemerkungen nicht als Aufruf zur Gewalt verstanden werden:
„Mit dem Erstarken der AfD besteht die Gefahr des Wiederentstehens einer faschistischen Partei mit bundesweitem Masseneinfluss. Es ist deshalb notwendig, die AfD auf der Straße und in den Parlamenten zu stoppen.“
Auch viele weitere Bemerkungen sind in ihrer Radikalität fragwürdig:
„Die Täter*innen werden durch ein gesellschaftliches Klima ermutigt, in dem der Wert von Menschenleben in Frage gestellt wird.“
Es ist keine Überraschung, dass die Linke die Genderschreibweise verwendet. Und sie tut dieses konsequent. Prostituierte heißen hier politisch korrekt „Sexarbeitern*innen“ (wieso nicht „Sexarbeiter*innen“?). Jüdische Menschen werden auch so genannt und nicht gegendert im Gegensatz zu den „Muslim*innen“. Das geht analog zu den Schreibweisen bei den Grünen. Von dort kennen wir auch die Formen „Sinti*zze“ und „Rom*nja“. Hier werden auch weitere Minderheiten mit Gender-Sternchen geschrieben: „Dän*innen“, „Fries*innen“ sowie „Sorb*innen“ und „Wend*innen“. Müsste es dann konsequenterweise auch die Deutsch*innen heißen? Immerhin wird auch beim politischen und gesellschaftlichen Gegner gegendert, etwa bei den „Profiteuren*innen“ und „Täter*innen“. Diversity findet sich demnach in allen Lagern, ob Freund oder Feind.
Dass das gesamte Programm so ausladend ist, liegt auch daran, dass sich einige Aussagen unter unterschiedlichen Themenschwerpunkten wiederholen. Dies macht das Programm an vielen Stellen redundant.
Kann die Linke aber auch bürokratisch? Wir haben auch hier beim Thema Digitalisierung nachgeschaut und sind auf folgenden Satz gestoßen. Dieser ist so herrlich kompliziert, dass er zum Liebling unserer Lieblingssätze geworden ist:
„Durch ein Plattformstrukturgesetz wollen wir Selbstbegünstigung der IT-Unternehmen verbieten, Datenschutz sicherstellen sowie die Interoperabilität und Portabilität der Nutzerdaten sanktionsbewährt garantieren.“
























Schreibe einen Kommentar