
Bürgernah digitalisieren!
Die revolutionären Veränderungen der Digitalisierung können enormen Nutzen stiften. Sie können aber auch ein Einfallstor für ‚Zeitdiebstahl‘ und Fremdsteuerung sein. Das gilt auch für unsere Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung: Auch hier drohen manipulative „Time-Bandits“.
Von Dr. Ulrich Horstmann
Mit der Digitalisierung bleibt uns durch weniger monotone Tätigkeiten unseres Lebens mehr Raum für Kreativität. Doch entscheidend ist, dass wir mit Digitalisierung richtig umgehen. Denn: Die zeitaufwendige Eigenverwaltung unserer Daten könnte zugleich mit ‚Nudging‘ und “Arbeitsverlagerung” auf den Bürger verbunden werden. Mit dem Umstieg auf Eigenverwaltungsplattformen, die angeblich ganz smart und einfach sowie nur Vorteile bringen, werden auch – das sollte nicht vergessen werden – leicht analoge Alternativen immer mehr ‚abgeschaltet‘ bzw. verunmöglicht. Bürgernähe und behördliche Handreichungen könnten auf der Strecke bleiben.
Wenn man mit eher technokratisch ausgerichteten Digitalisierern in der Verwaltung kooperieren muss, wird man mehr und mehr gefordert und bekommt unter Umständen sehr wenig dafür. Die Anbieter sparen sich eigene Verwaltungskosten, wenn sie alles selbst erledigen. Wir helfen so unseren ‚Staatsdienern‘ eine Bürokratie aufrechtzuerhalten, die eher an die Werke von Franz Kafka erinnern lässt.
“Zum Leben und Arbeiten kommt man so kaum mehr, dafür sorgen zunehmend unsere völlig überbürokratisierte EU und unser Staat”
Vieles erscheint schon heute nur noch absurd und die EU mischt mit. Betriebe werden durch zunehmende Dokumentationspflichten gegängelt. Beispiele: Lieferkettengesetz, DSGVO, Arbeitszeitnachweisgesetz, elektronische Krankschreibung, CSRD, ESRS, Energieeffizienzgesetz, Hinweisgeberschutzgesetz, EU-Taxonomieverordnung… Zum Leben und Arbeiten kommt man so kaum mehr, dafür sorgen zunehmend unsere völlig überbürokratisierte EU und unser Staat. Neue ‚Datenkraken‘, die Zeit für Markt und Wettbewerb verhindern.
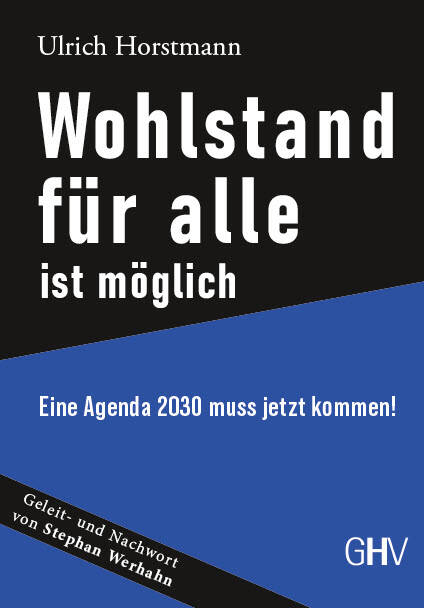
Ein anderes augenscheinliches Beispiel durften Immobilienbesitzer im Zuge der neuen Grundsteuerermittlung erleben. Diese war zwar über das ELSTER-System digitalisiert. Aber die Arbeit der Datenerhebung, selbst von öffentlich zugänglichen Daten, wurde schlechterdings auf den Steuerzahler abgewälzt.
Zwischen den Bürgern und dem Staat sollte stattdessen ein besonderes Vertrauensverhältnis bestehen bleiben. Auf jeden Fall sollte die Verwaltung bürgernah funktionieren. Leider ist das so genannte E-Government in Deutschland noch nicht auf dem Stand, wie wir das zu Recht erwarten können. Immerhin ist das Bemühen in dem Koalitionsvertrag erkennbar: „Wir setzen auf konsequente Digitalisierung und „Digital-Only“: Verwaltungsleistungen sollen unkompliziert digital über eine zentrale Plattform („One-Stop-Shop“) ermöglicht werden, das heißt ohne Behördengang oder Schriftform.“ (zitiert aus S. 56 des Koalitionsvertrages). Das sind starke Worte. Sie könnten auch eine fragwürdige Zentralisierung, die den Föderalismus aushöhlt, mit sich bringen.
Viele wollen keine Veränderung
Manchmal bleibt auch der analoge Weg sinnvoll, der Bürger fühlt sich längst nicht mehr von seinen Staatdienern abgeholt. Auf jeden Fall besteht Aufholbedarf bei einer bürgerfreundlichen Digitalisierung. Anderswo läuft es ohnehin schon viel besser, z. B. in Estland. In dem früher kommunistischen Land, das Teil der damaligen Sowjetunion war, sind fast sämtliche staatlichen Dienstleistungen inzwischen online.
Die 50 Trend- und Wachstumsbranchen auf DDW↗:
Trendfeld Digitale Services
 Für Unternehmen kaum noch verzichtbar, aber auch für öffentliche Verwaltungen dringend geboten: Digital und online verfügbare Angebote, Smart Services und Smart Solutions. 85 aus den 3.000 deutschen Unternehmen in Wachstumsfeldern↗ hat die DDW-Research identifiziert, die hier als besondere Akteure zu nennen sind – als Dienstleister, aber auch vorbildliche Anwender digitaler Services. Einer der führenden Experten auf diesem Gebiet ist die ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation mit Hauptsitz in Berlin und neun weiteren Standorten in Deutschland und Europa. Zu den Kunden gehören viele Bundesministerien. CEO Harald Felling verantwortet bei ]init[ die strategische Unternehmensentwicklung und berät Verwaltung und Wirtschaft bei ihrer digitalen Transformation (Bild: Unternehmen).
Für Unternehmen kaum noch verzichtbar, aber auch für öffentliche Verwaltungen dringend geboten: Digital und online verfügbare Angebote, Smart Services und Smart Solutions. 85 aus den 3.000 deutschen Unternehmen in Wachstumsfeldern↗ hat die DDW-Research identifiziert, die hier als besondere Akteure zu nennen sind – als Dienstleister, aber auch vorbildliche Anwender digitaler Services. Einer der führenden Experten auf diesem Gebiet ist die ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation mit Hauptsitz in Berlin und neun weiteren Standorten in Deutschland und Europa. Zu den Kunden gehören viele Bundesministerien. CEO Harald Felling verantwortet bei ]init[ die strategische Unternehmensentwicklung und berät Verwaltung und Wirtschaft bei ihrer digitalen Transformation (Bild: Unternehmen).
Während der Corona-Krise hatten es viele Amtsträger relativ angenehm. Viele wollen keine Veränderung. Mit einer solchen Rückständigkeit wird unser Land immer mehr den Anschluss verpassen. Insbesondere die FDP sprach sich in ihrem Wahlprogramm für eine gut koordinierte Digitalisierung aus. Sie soll auch bürgerfreundlicher sein, „Amtsgänge sollen virtuell und barrierefrei möglich und alle Dienstleistungen mit digitalen, medienbruchfreien Verfahren durchführbar sein“. Das klang gut.
“Auch bei der Digitalisierung muss es um Wege zur bürokratischen Entlastung gehen, nicht um immer mehr staatliche Kontrolle”
Doch die FDP ist leider bei der letzten Bundestagswahl gescheitert. Ihr ordnungspolitisches Korrektiv fehlt jetzt in der Regierungsarbeit. Sie hatte ein strukturelles Problem in der Ampelkoalition. Sie musste als kleine mitregierende Partei oft faule Kompromisse mittragen. Die Ampelregierung war, wie wir inzwischen wissen, voll davon. Die neue schwarz-rote Regierung sollte hier deutlich zulegen, immerhin soll der flächendeckende Breitbandausbau vorangetrieben werden. Das ist dringend notwendig. Es muss jetzt darum gehen, in eine bessere Digitalinfrastruktur zu investieren, Standards zu vereinheitlichen und ordnungspolitische Rahmenbedingungen zu verbessern, die unserer föderalen Struktur entsprechen.
Ein Lenkungsstaat von oben mit einer zielgerichteten digitalen grünen EU-Industriepolitik, die die Bürger mehr und mehr gängelt, wäre der falsche Weg. Auch bei der Digitalisierung muss es um Wege zur bürokratischen Entlastung gehen, nicht um immer mehr staatliche Kontrolle. Trotz der Verlockungen von Seiten der Regierung, den Bürger zu überwachen, um den Bürgern Sicherheit und Stabilität vorzuspiegeln, sollte davon Abstand genommen werden. Das Vertrauen zwischen Bürger und Staat wäre verloren, wenn es nicht vorrangig um den Bürger und die Regelung seiner Behördenangelegenheiten geht.
Erschienen in der Kolumne von Ulrich Horstmann:
- Bürgernah digitalisieren!
- Für eine bessere Einwanderungspolitik!
- Für eine günstige und ressourcenschonende Energieversorgung!
- Für eine bessere Bildung!
Dr. Ulrich Horstmann studierte in Bochum Betriebswirtschaftslehre, danach in Trier mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt und schloss an der Wirtschaftsuniversität Wien mit der Promotion ab. Seit 1989 ist er in mehreren Finanzinstituten im Research tätig. Zusammen mit Stephan Werhahn führt er das Institut Europa der Marktwirtschaften.























Schreibe einen Kommentar